| Erstellung | 30.10.13 |
|---|---|
| Letzte Änderung | 14.04.23 |
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 5.5°/47.25° | 15.5°/55.2° |
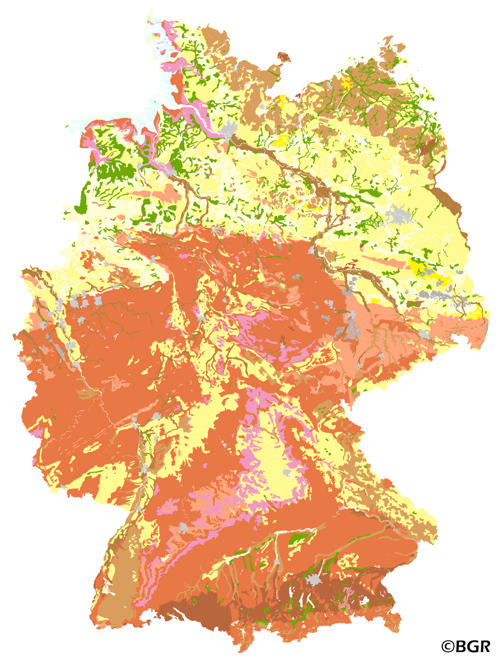
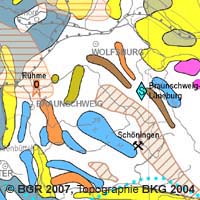
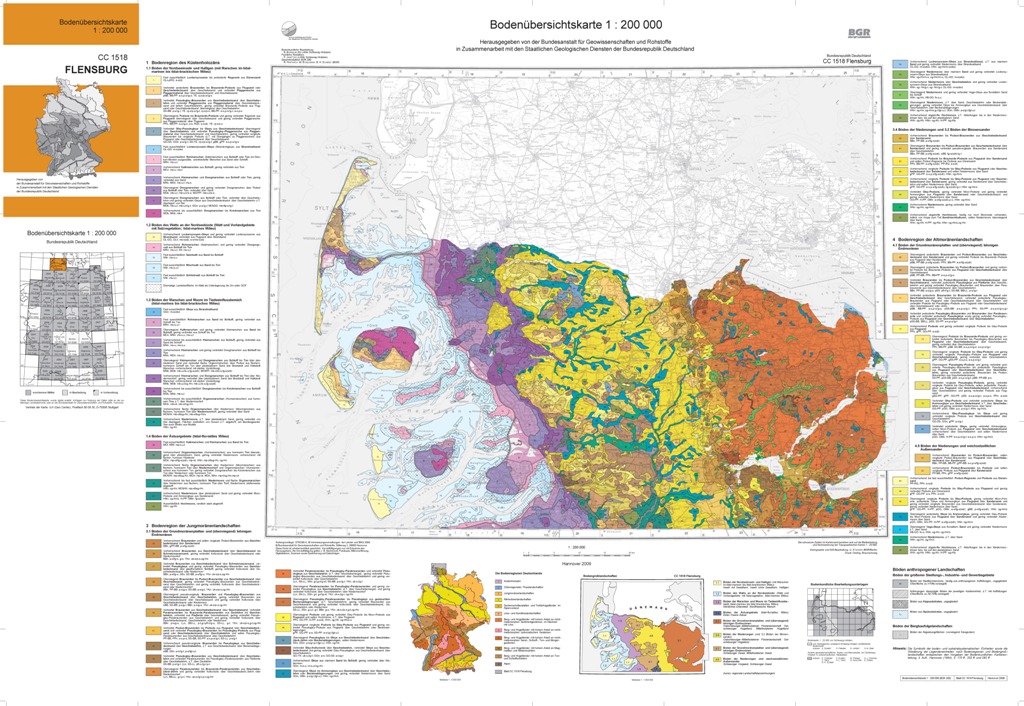
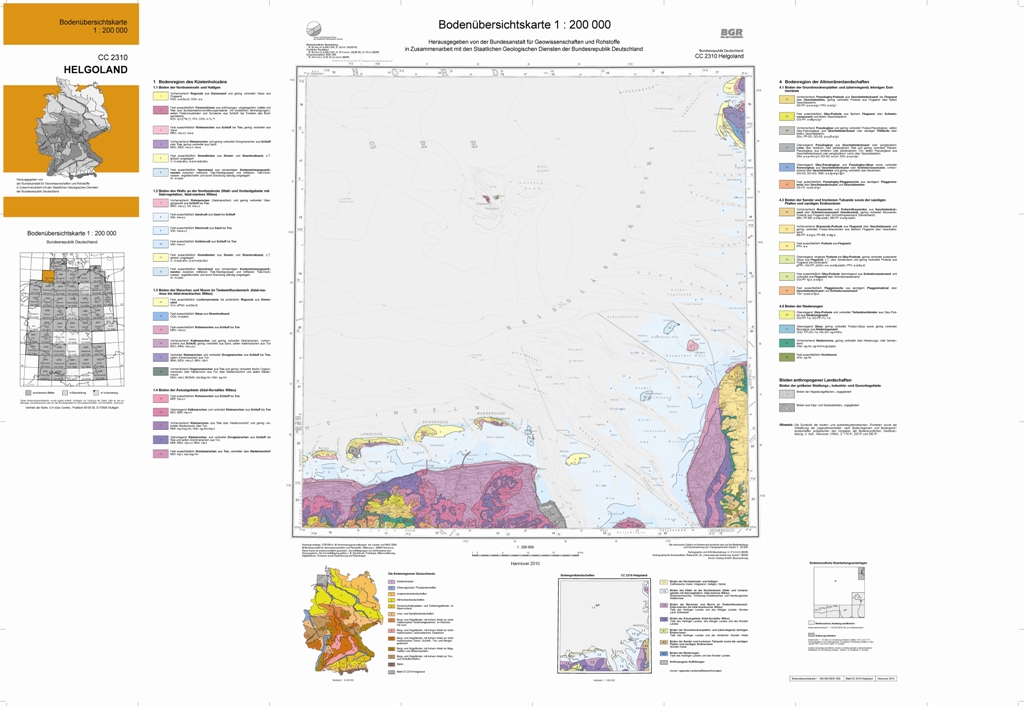
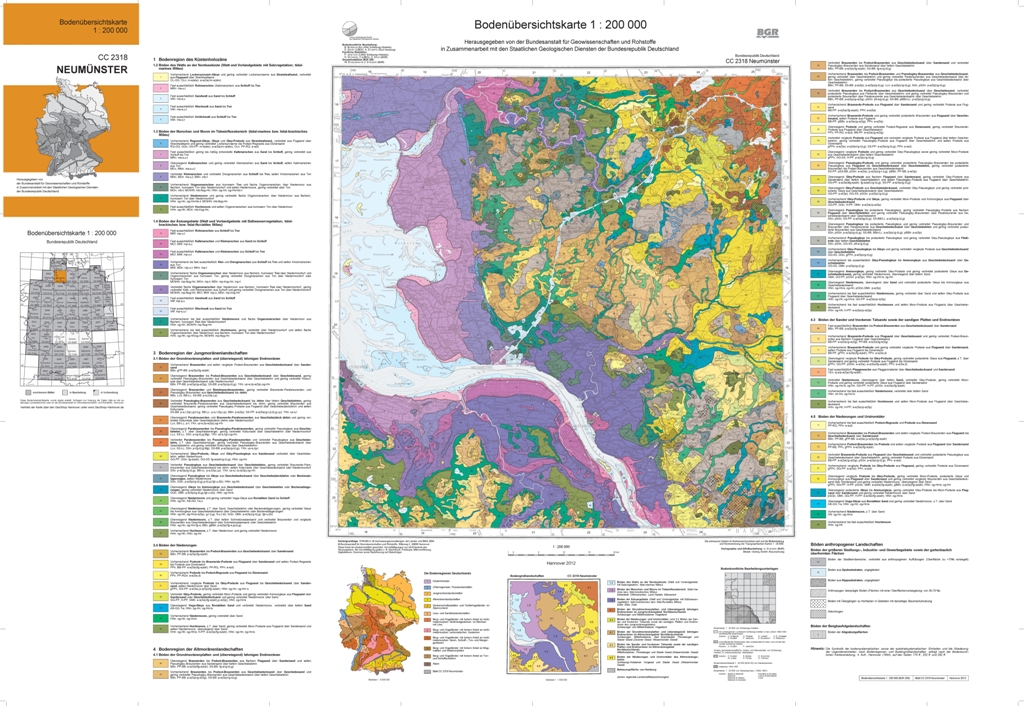
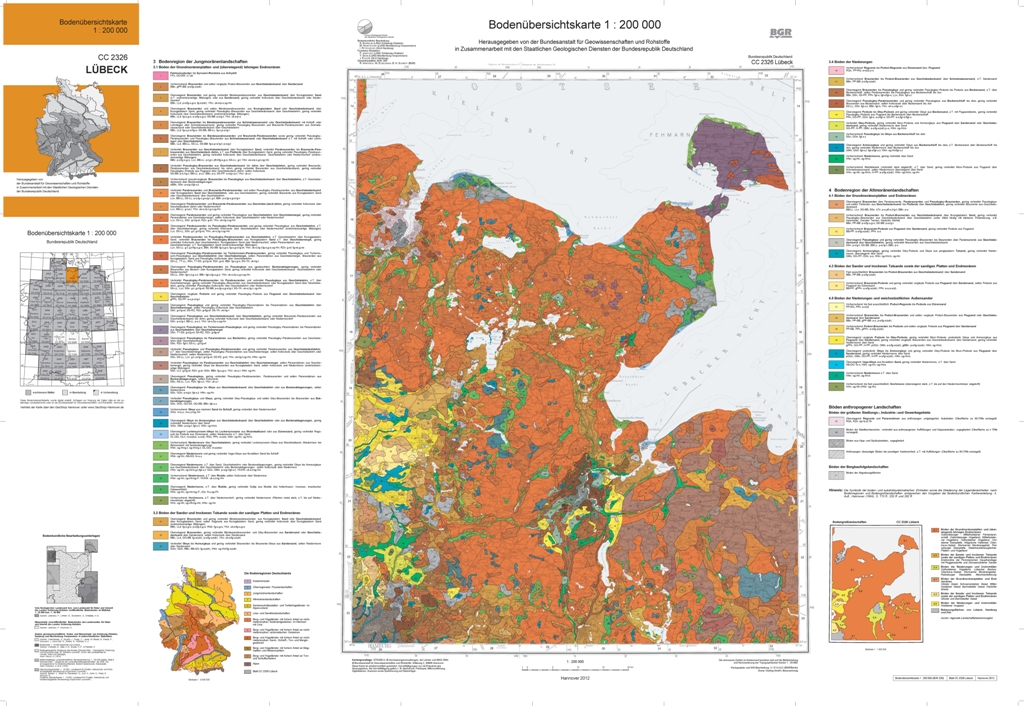
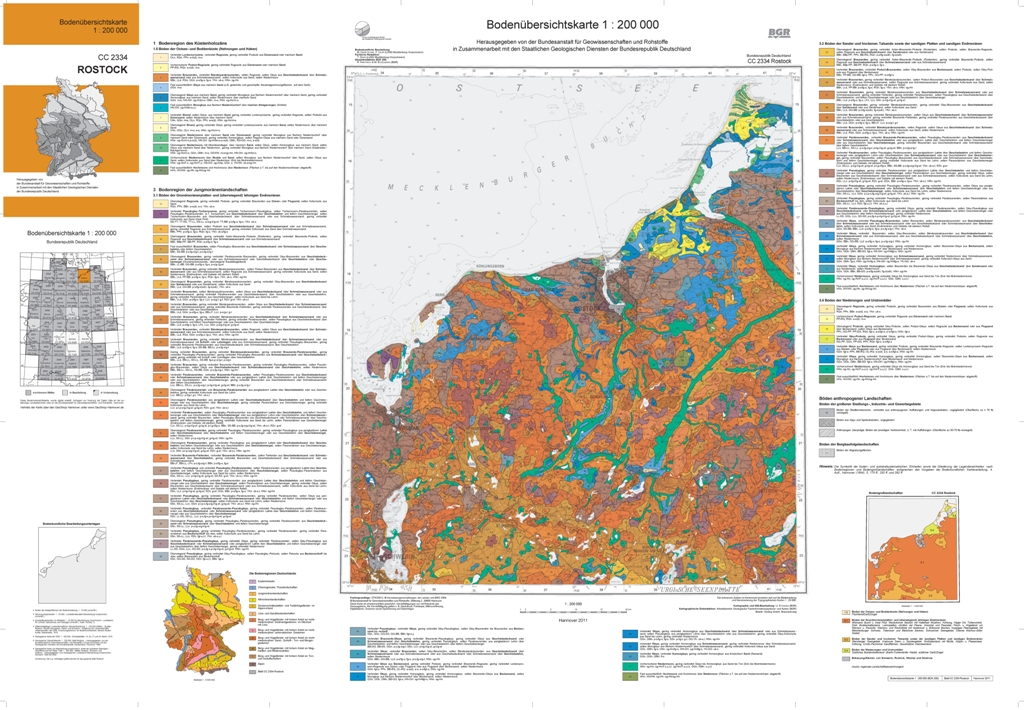
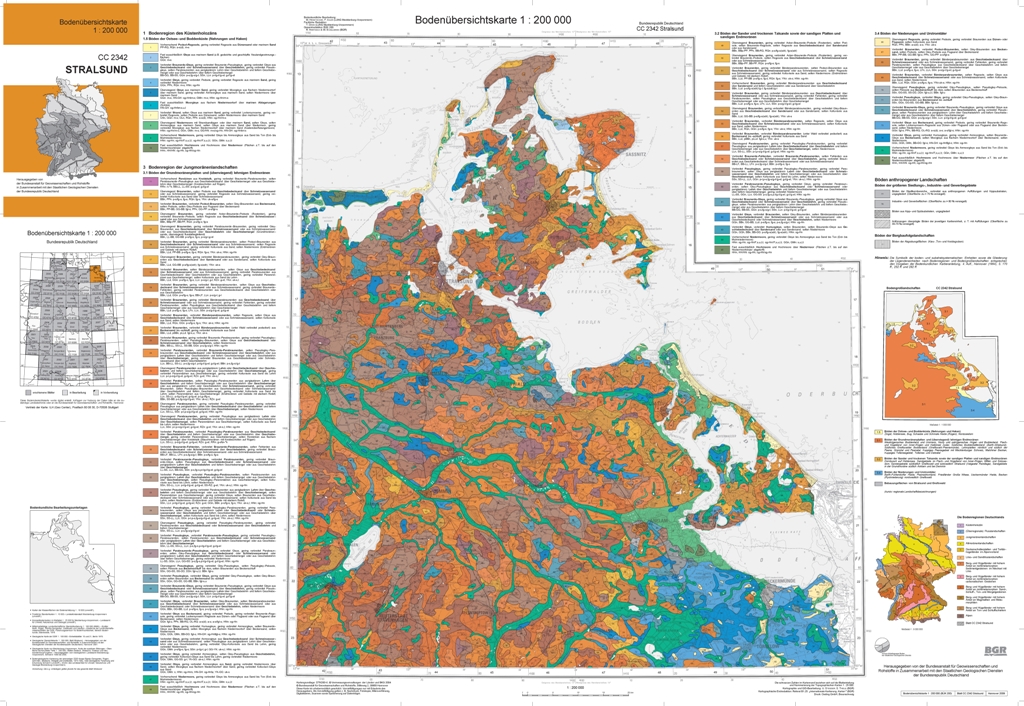
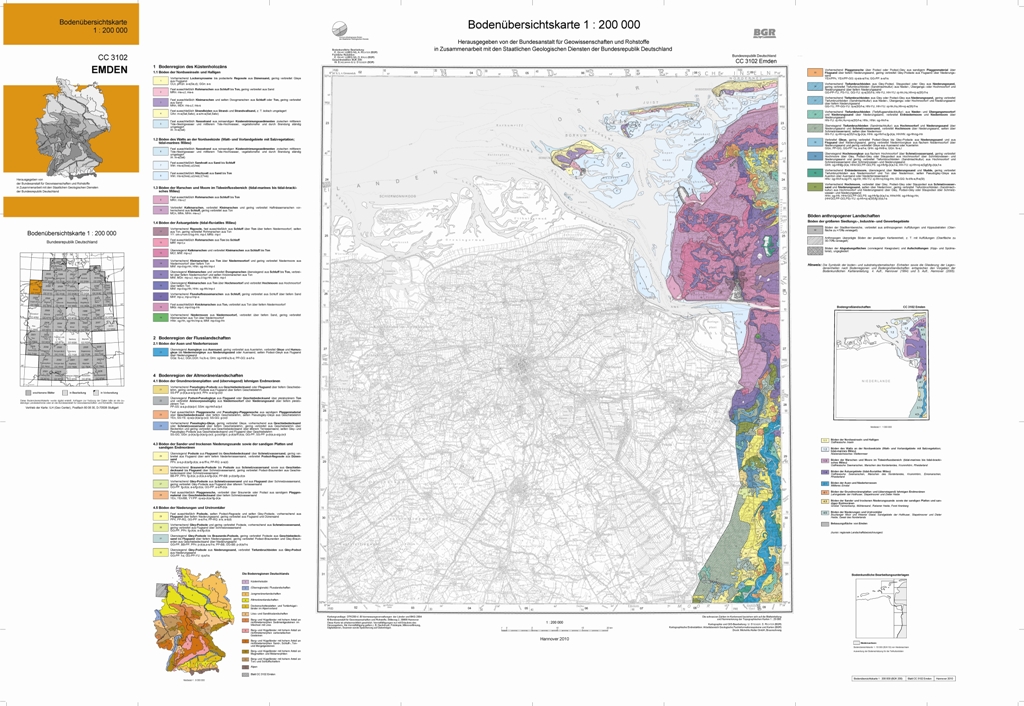
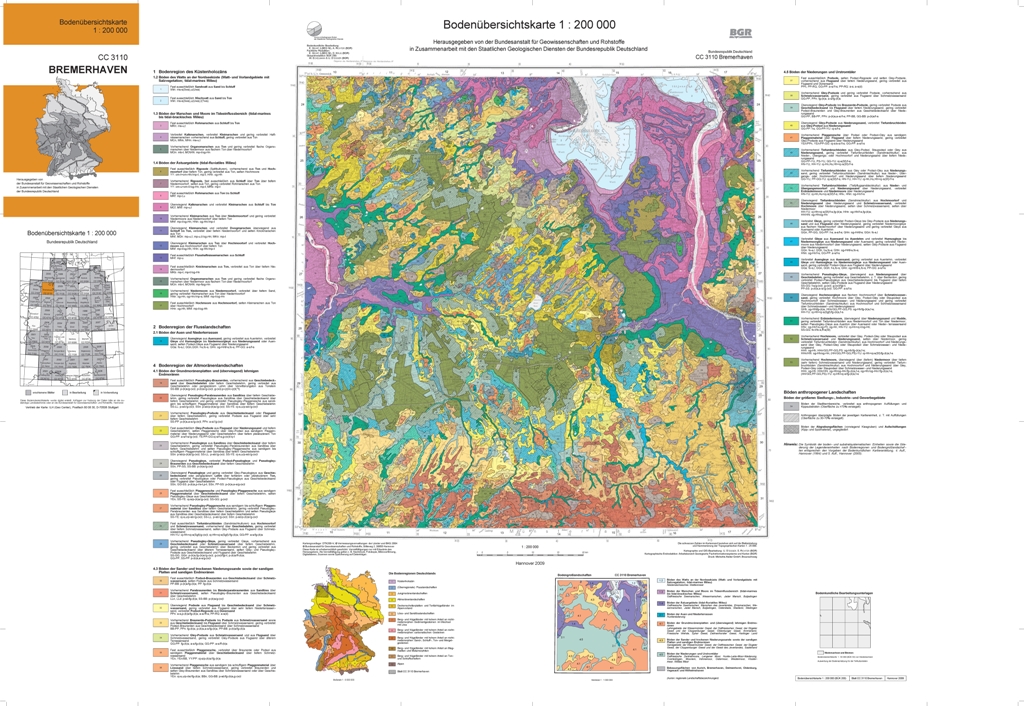
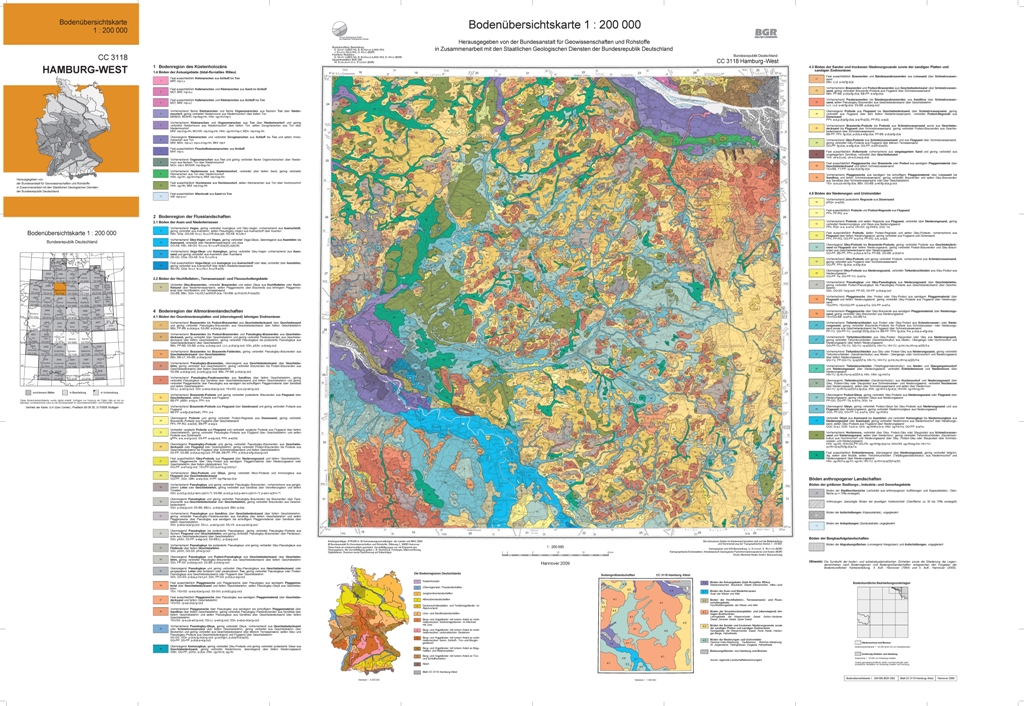
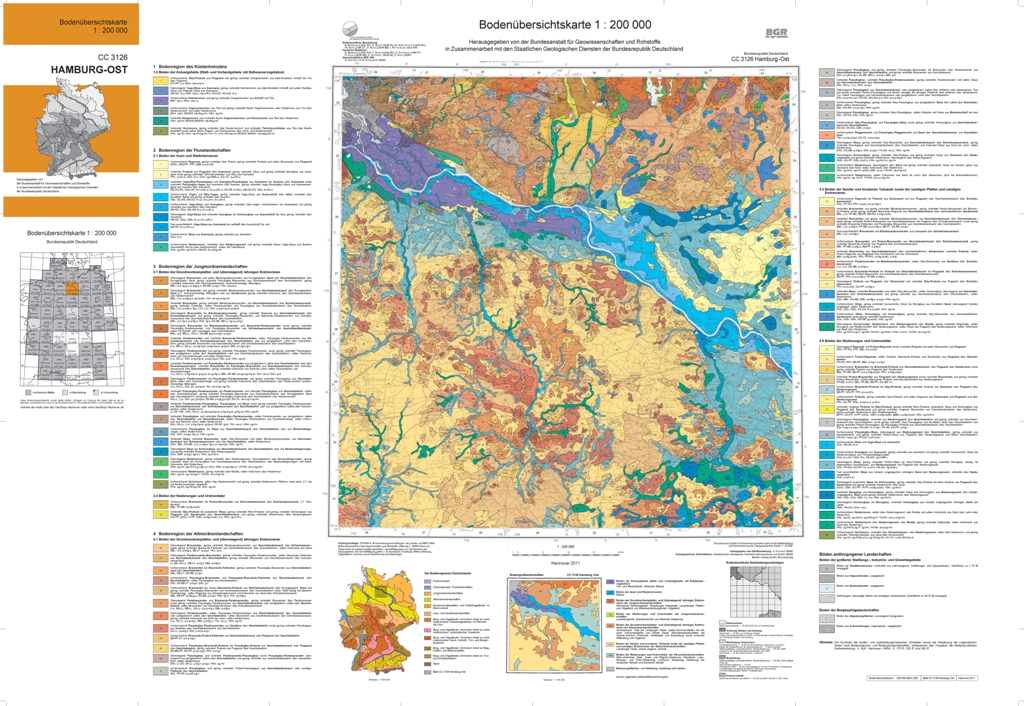
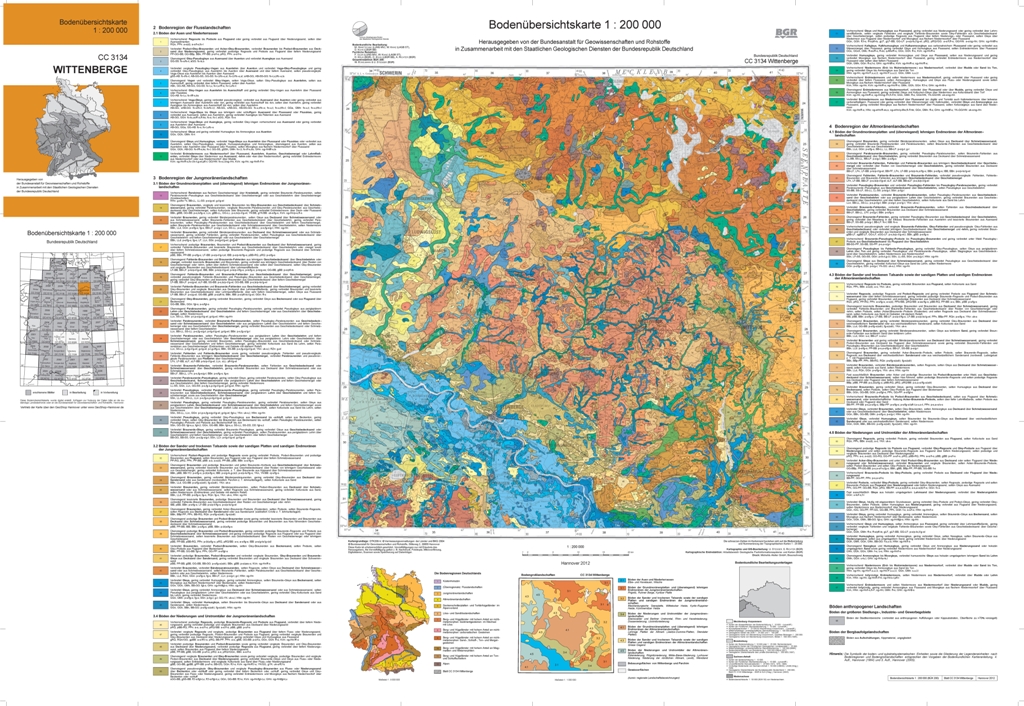
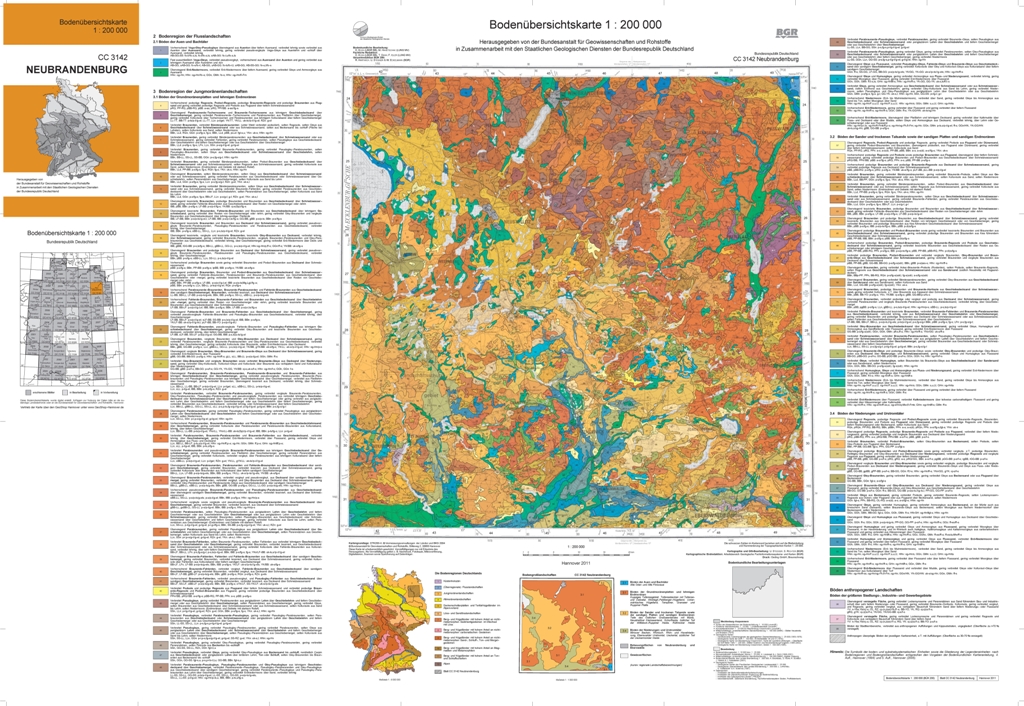
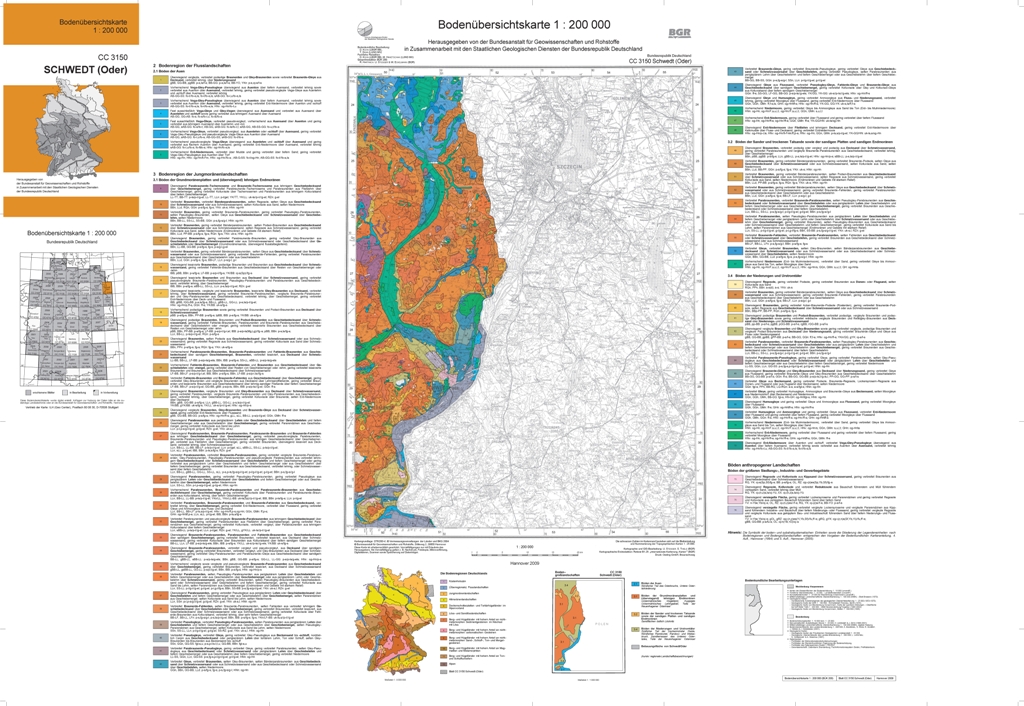
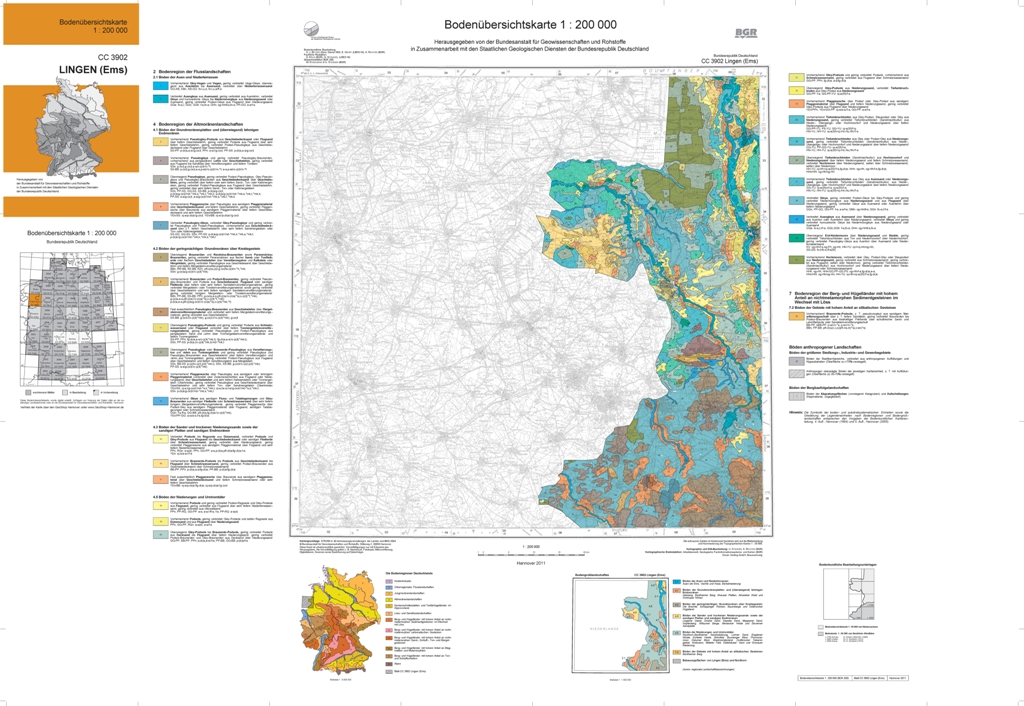
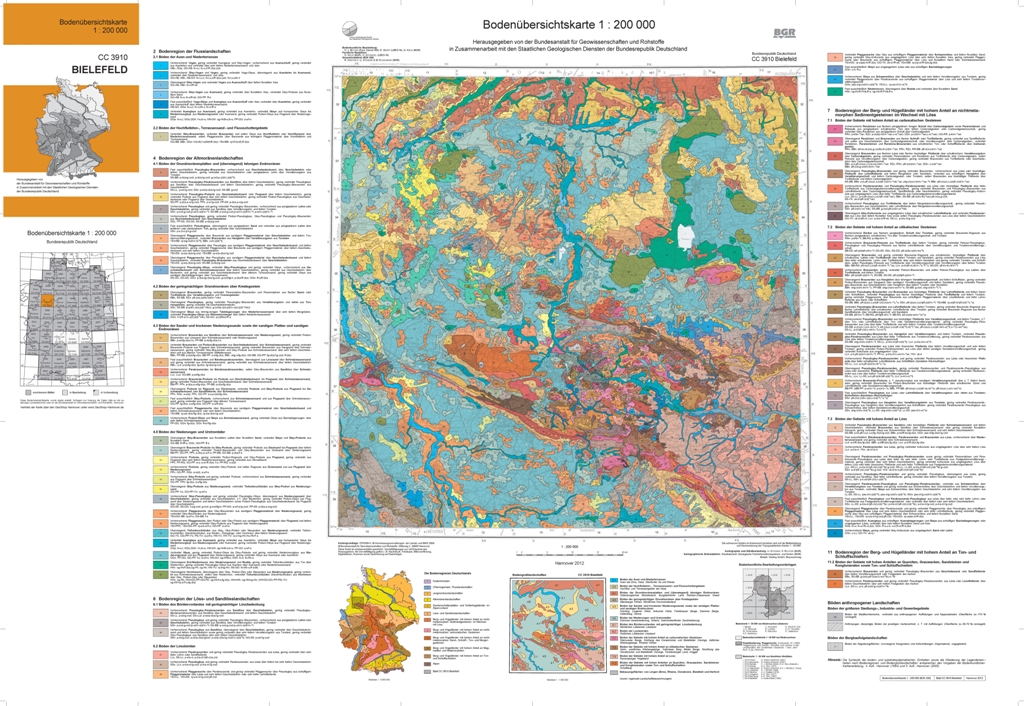
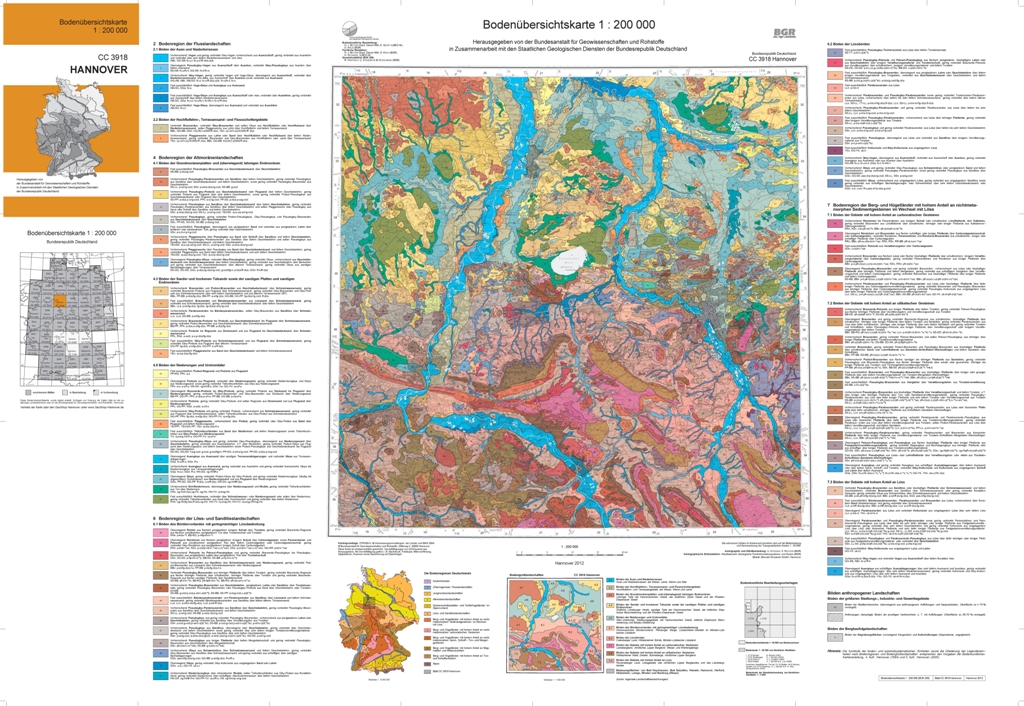
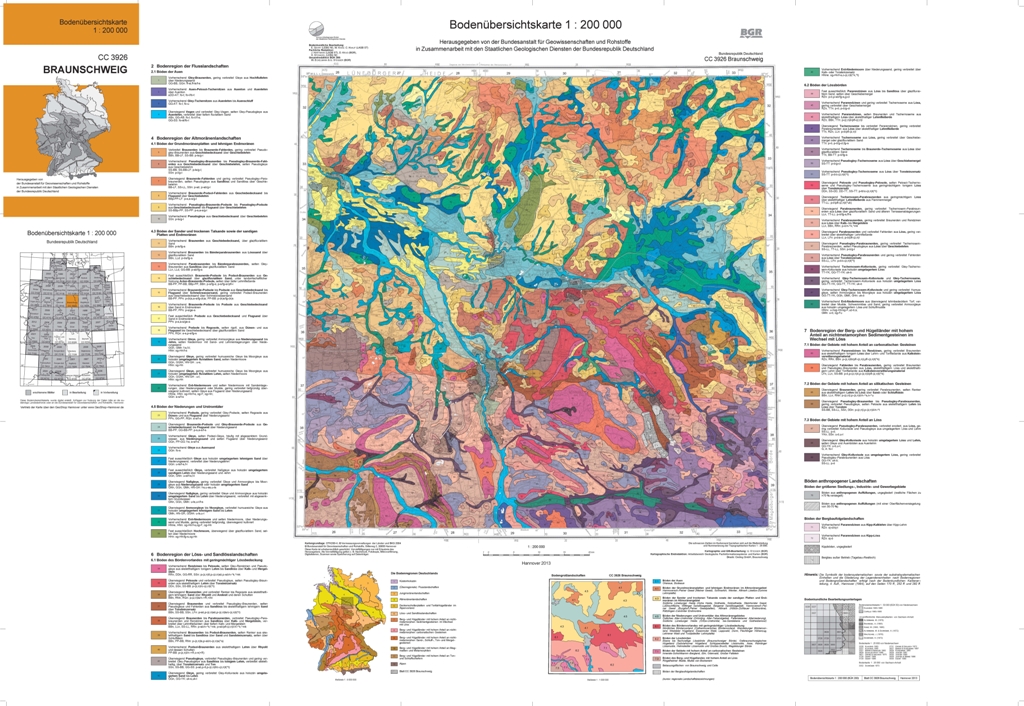
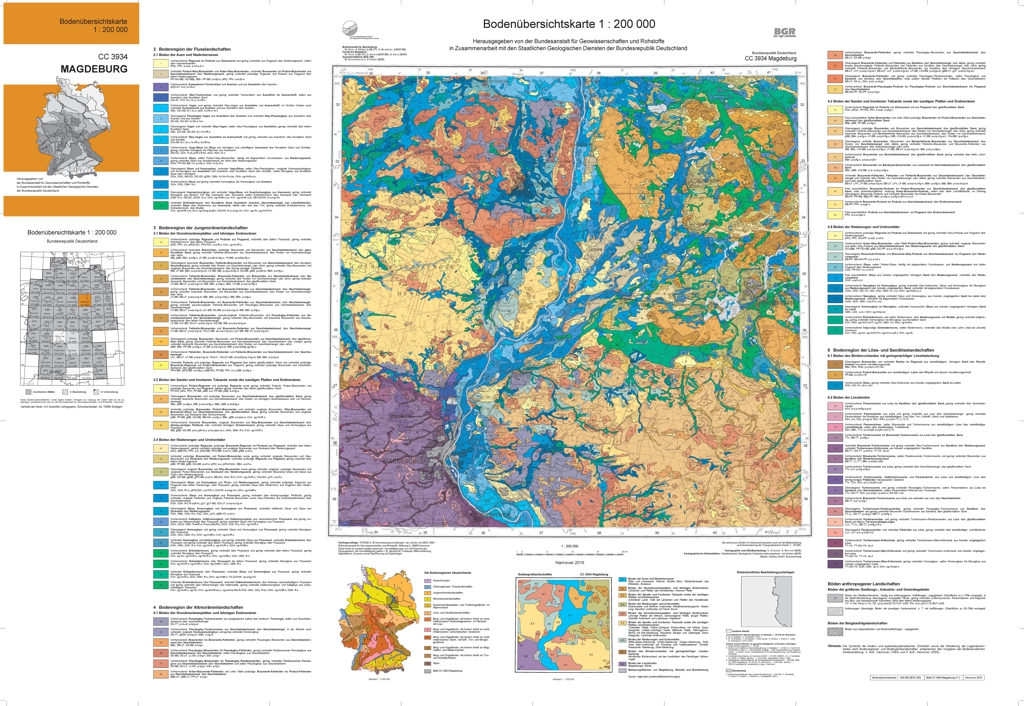
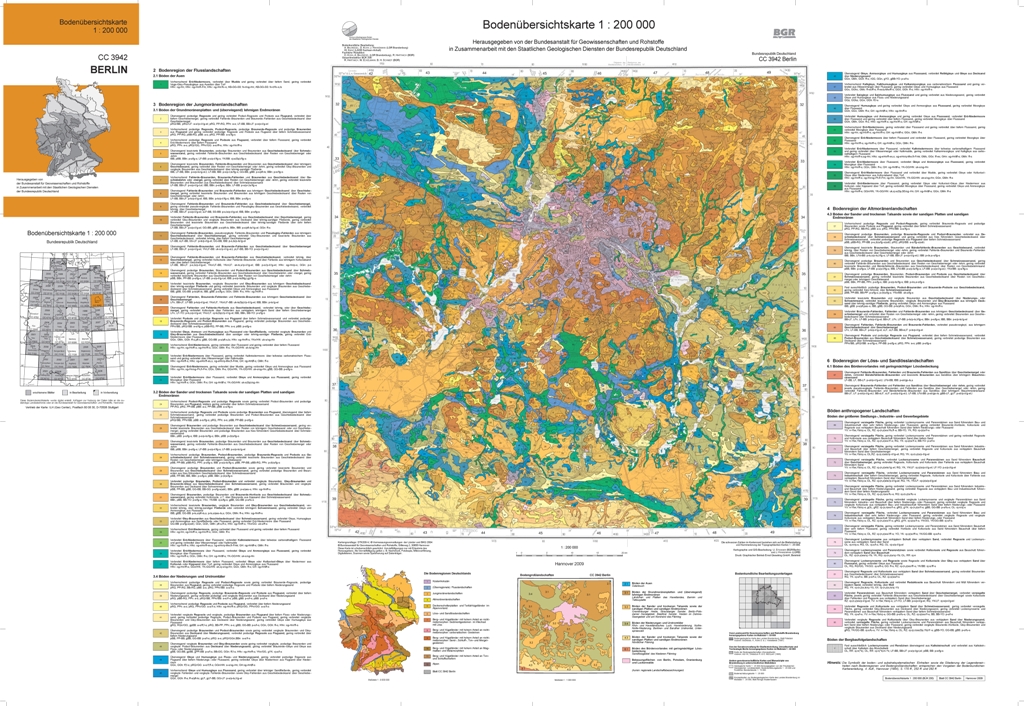
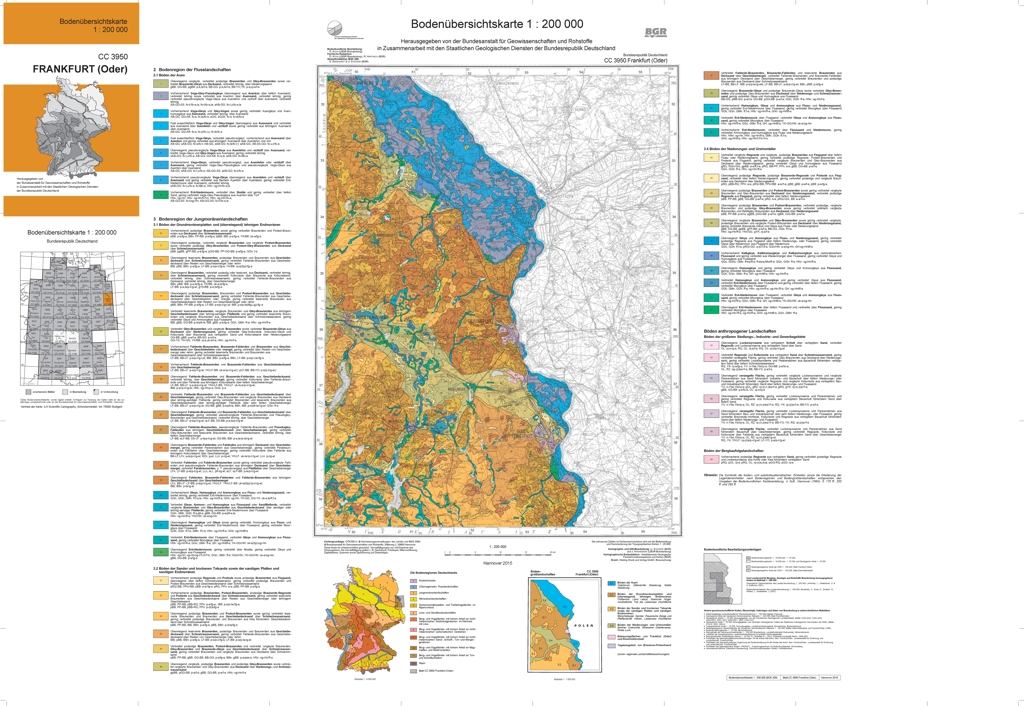
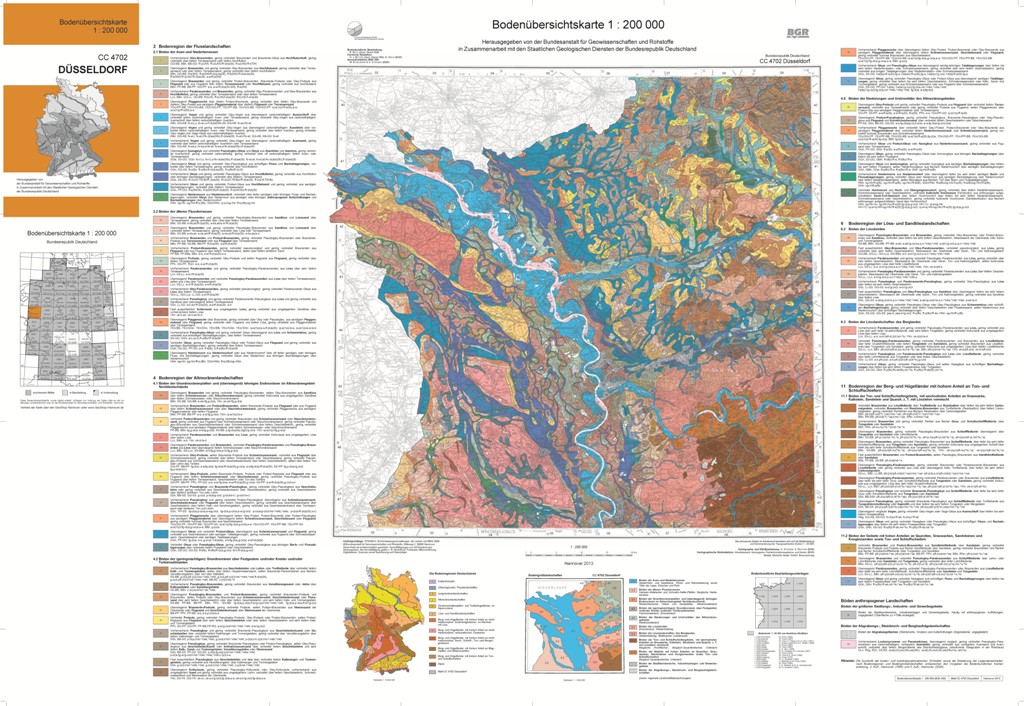
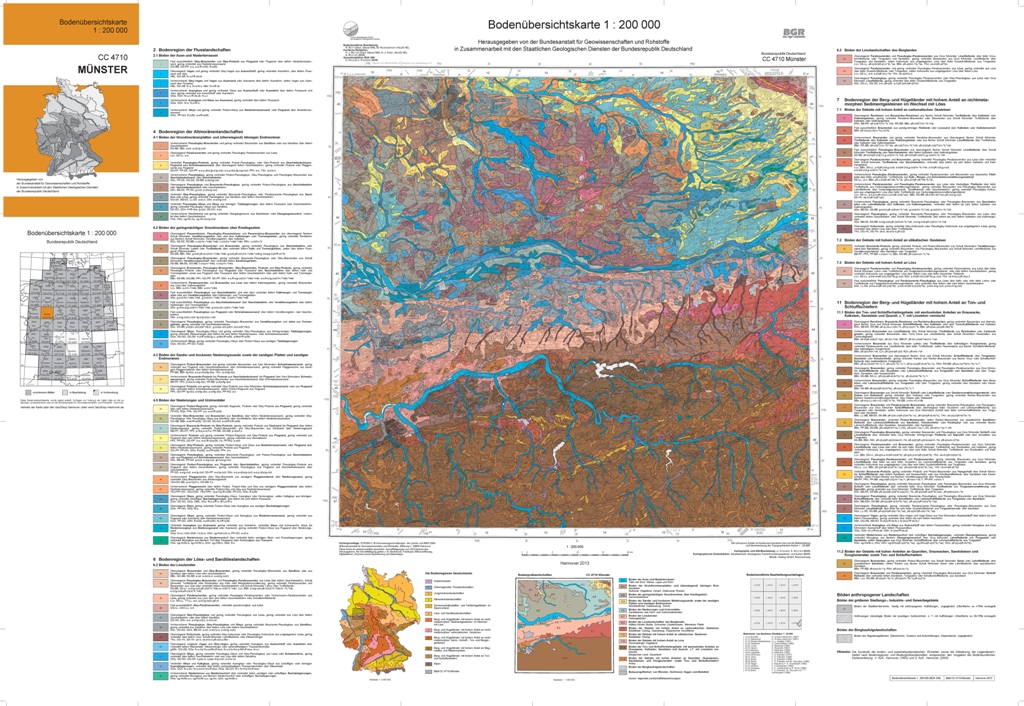
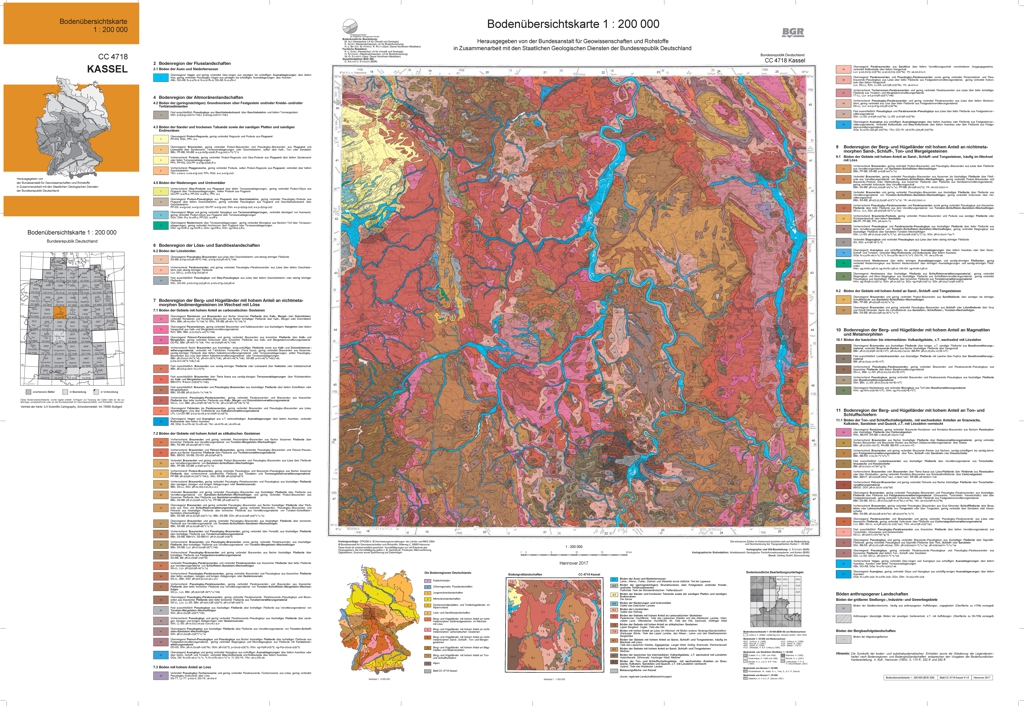
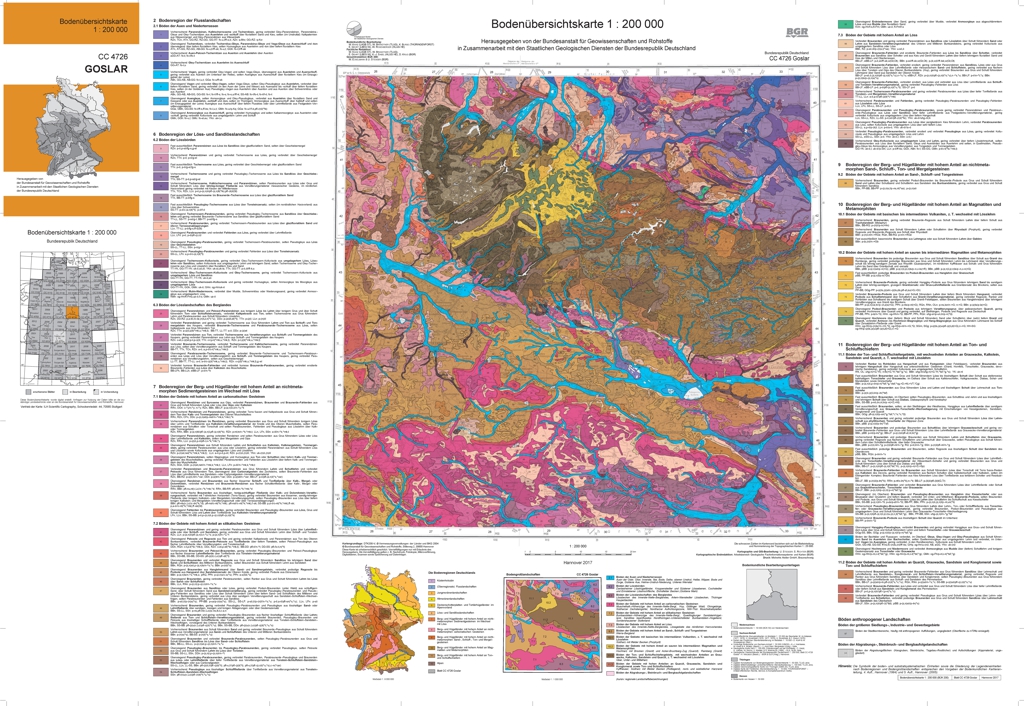
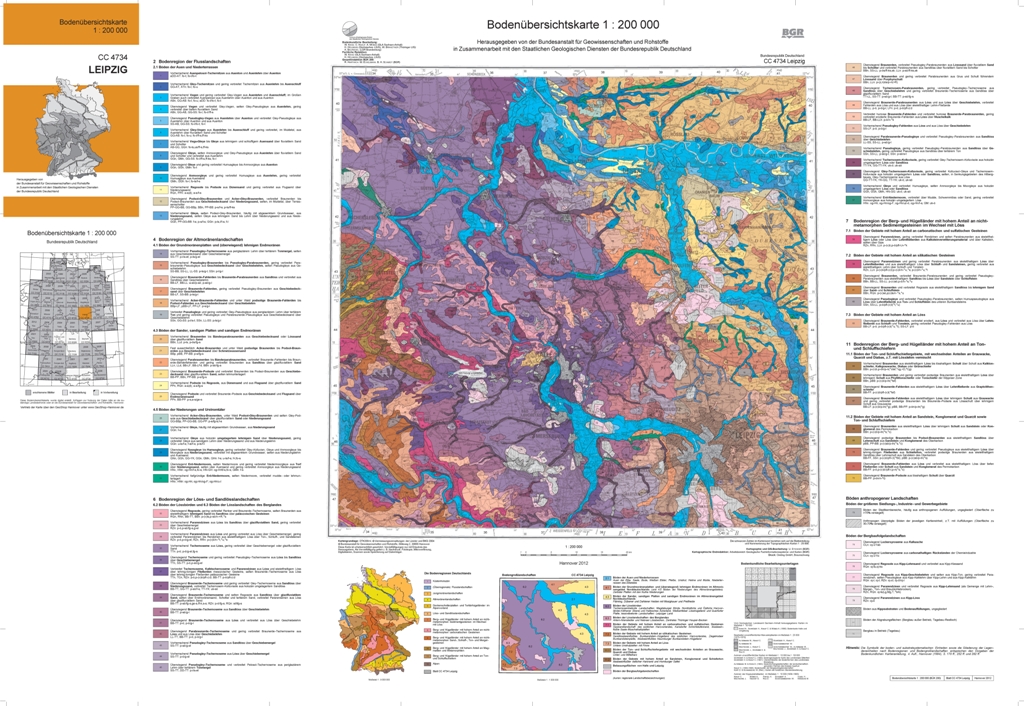
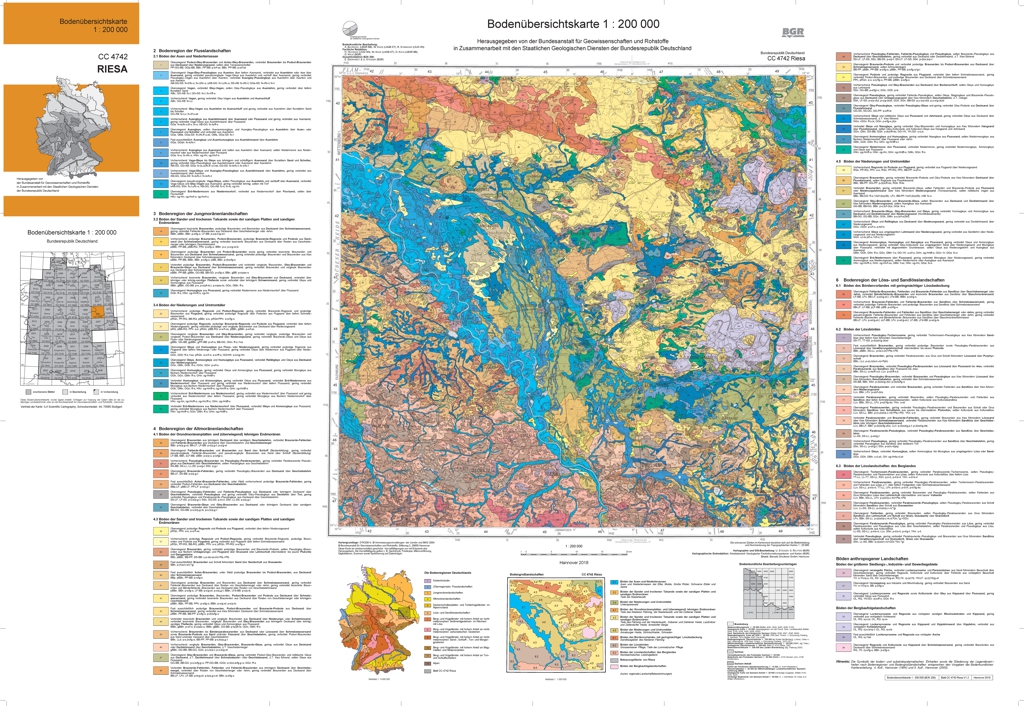
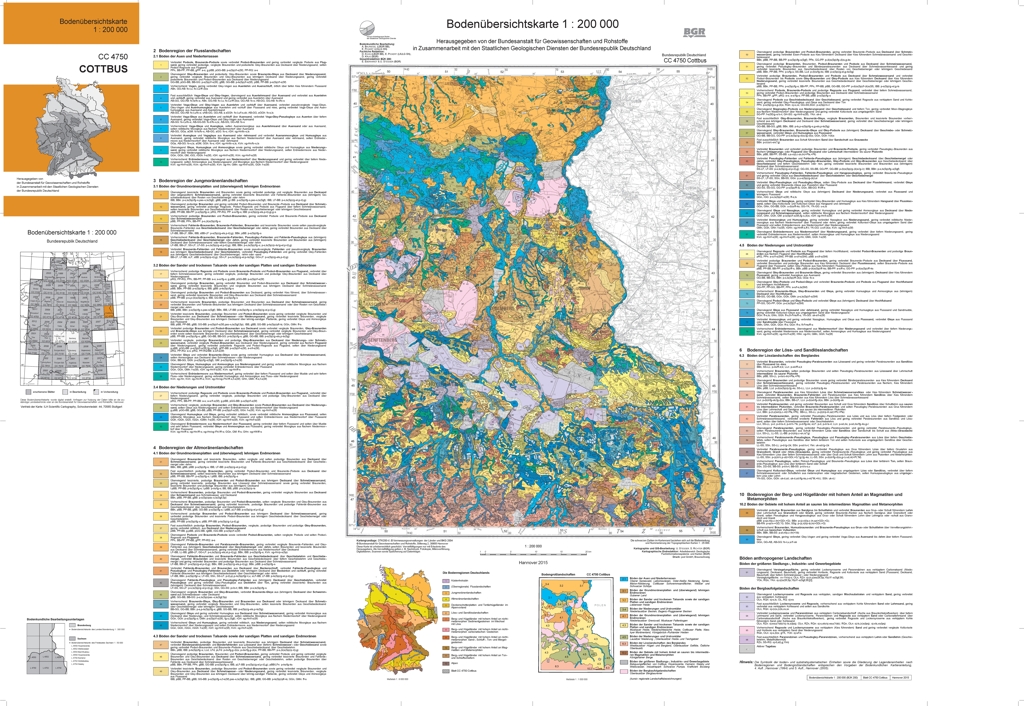
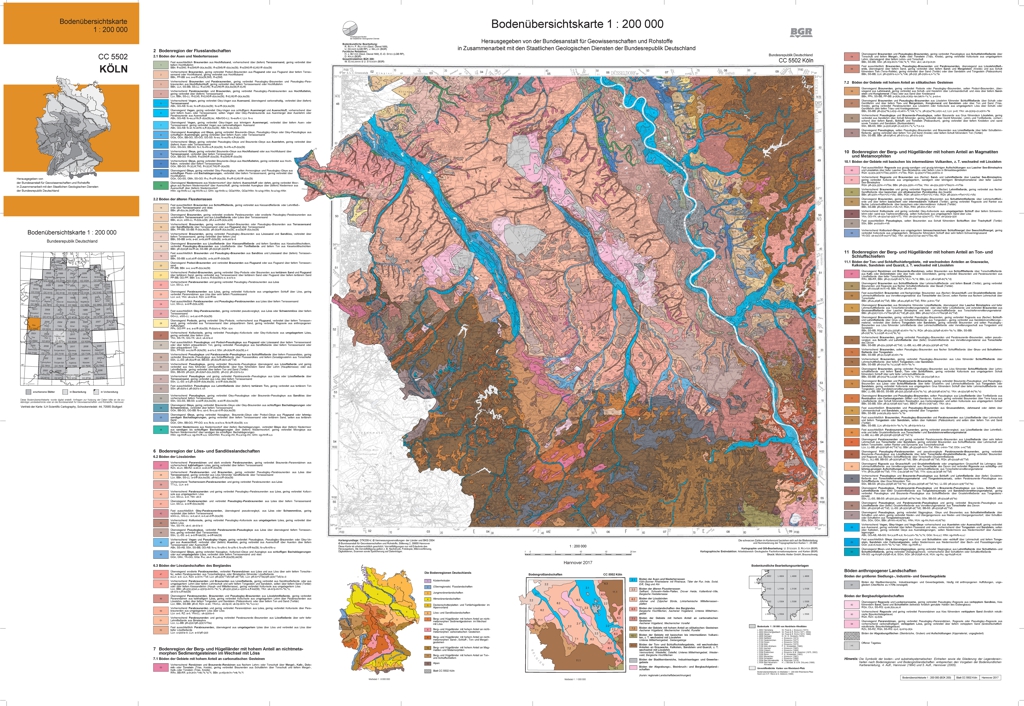
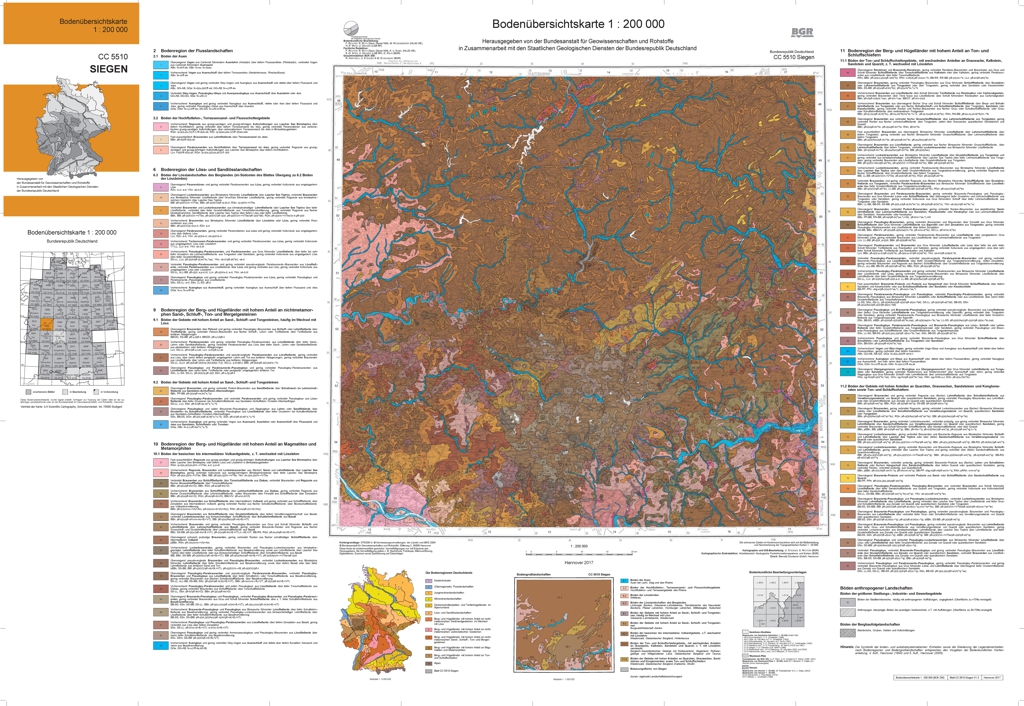
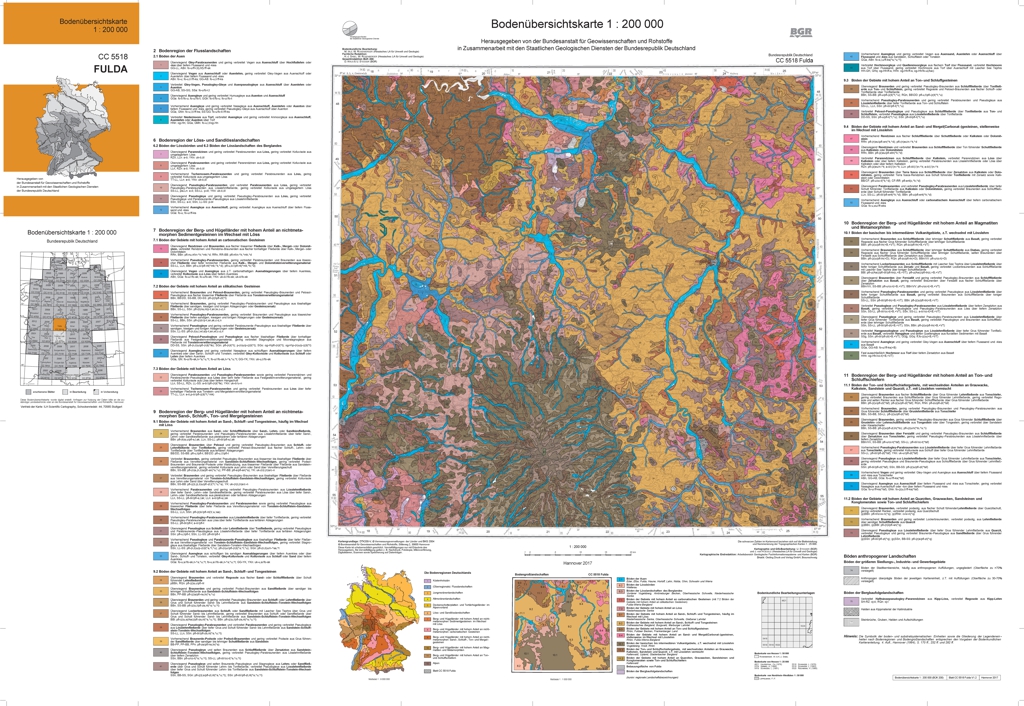
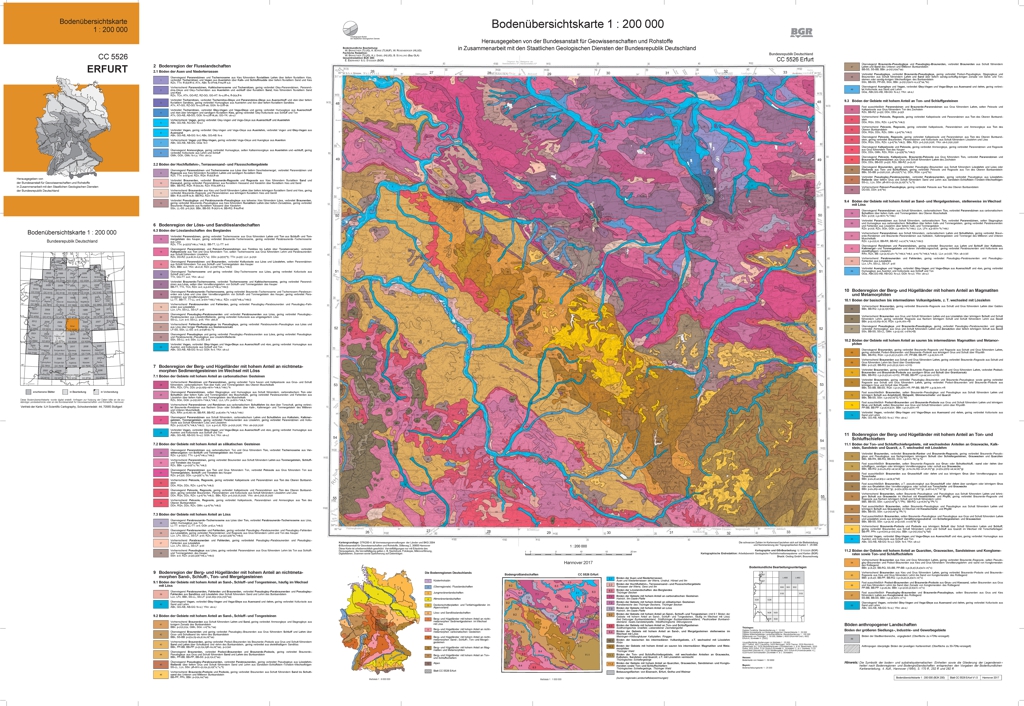
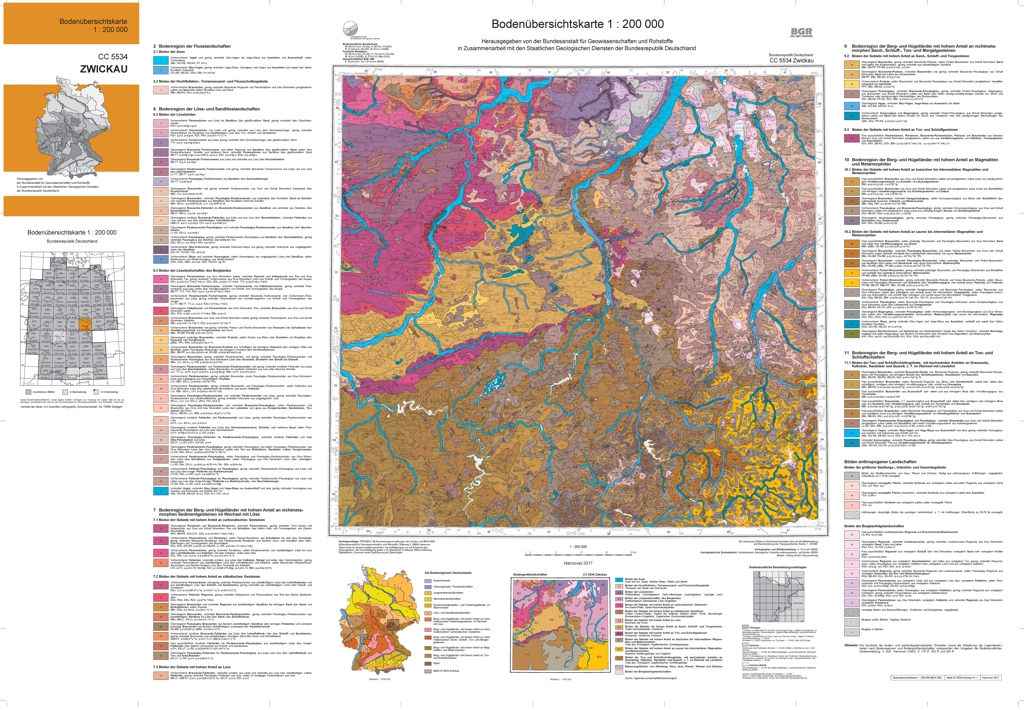
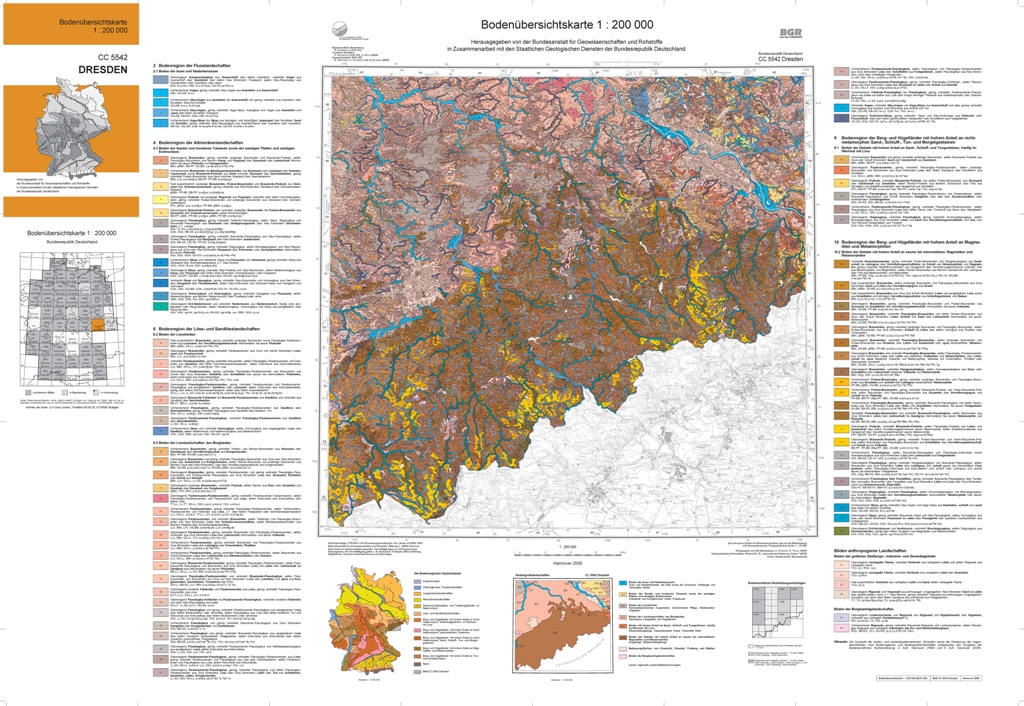
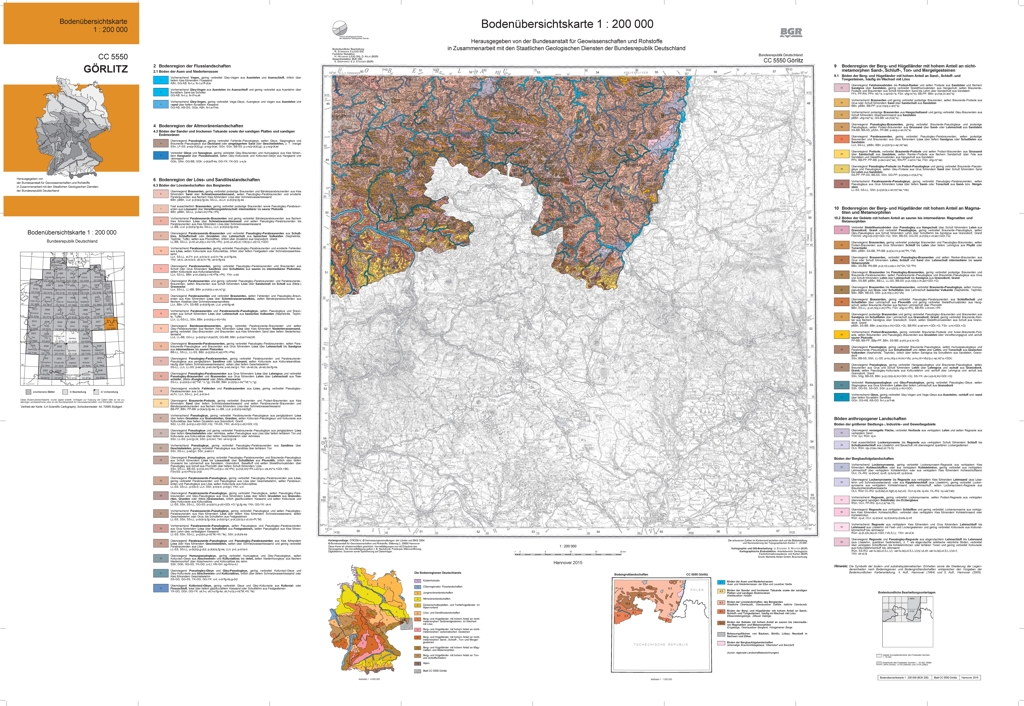
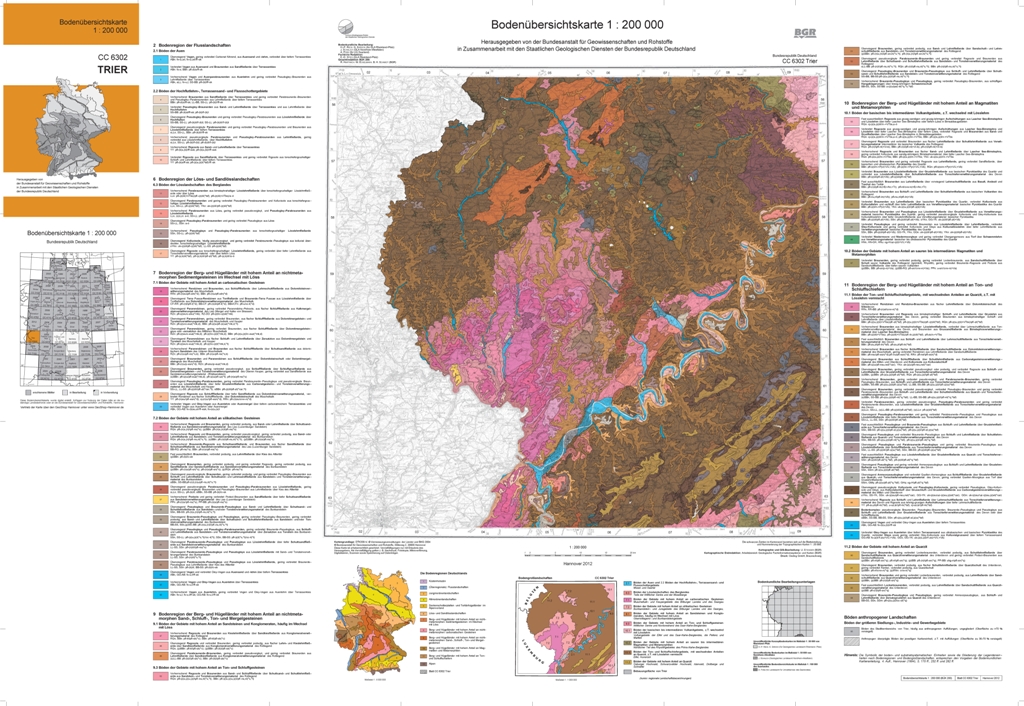
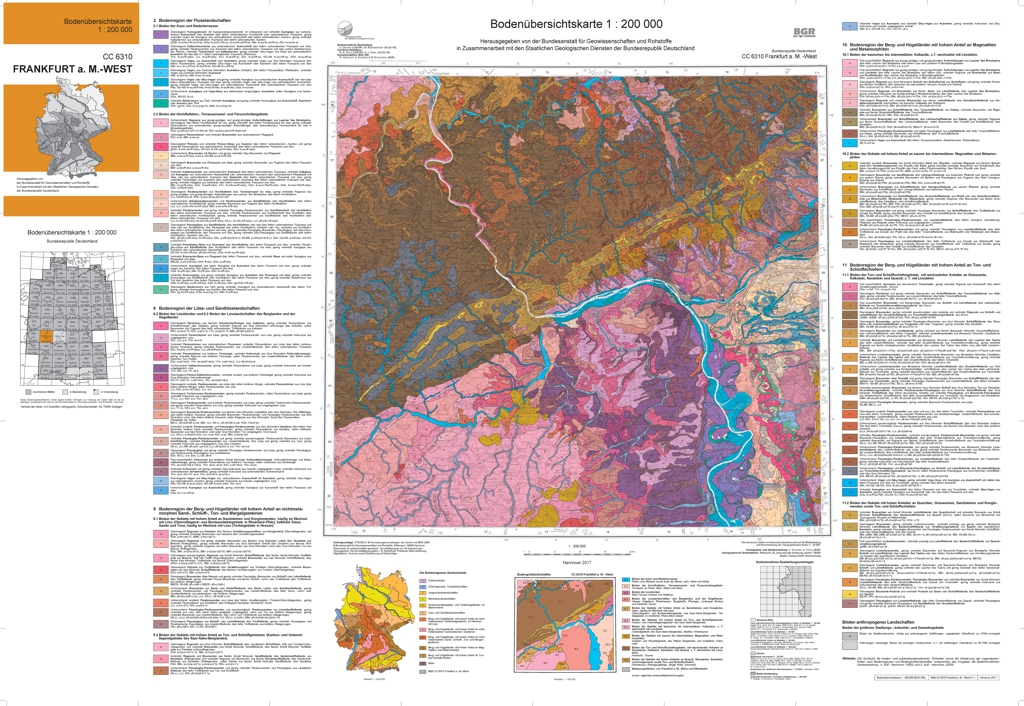
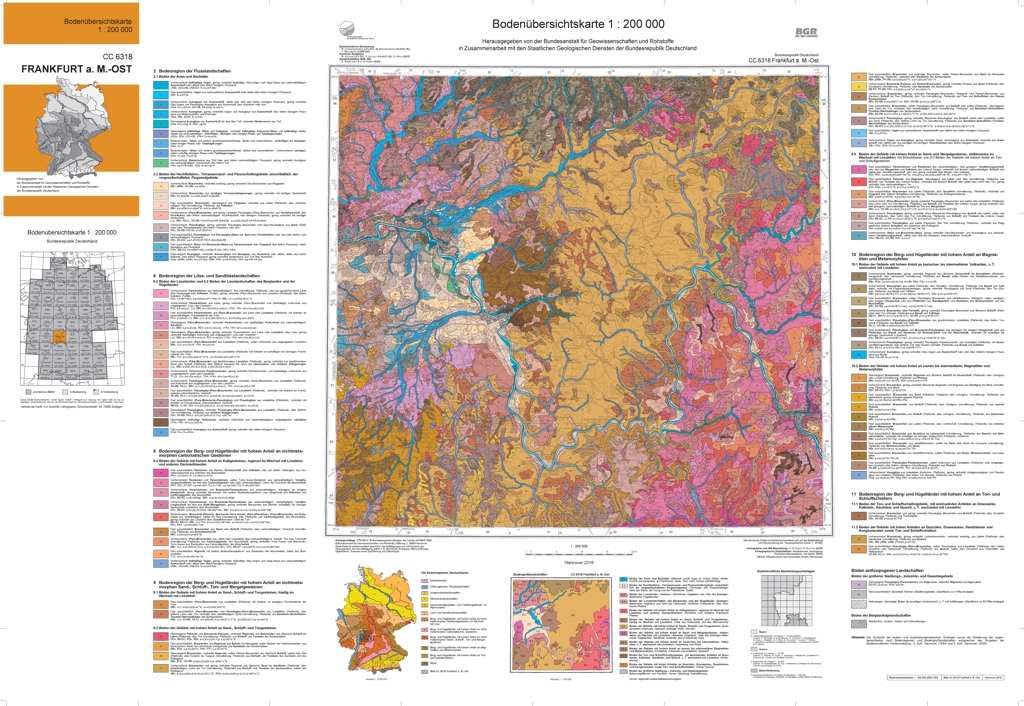
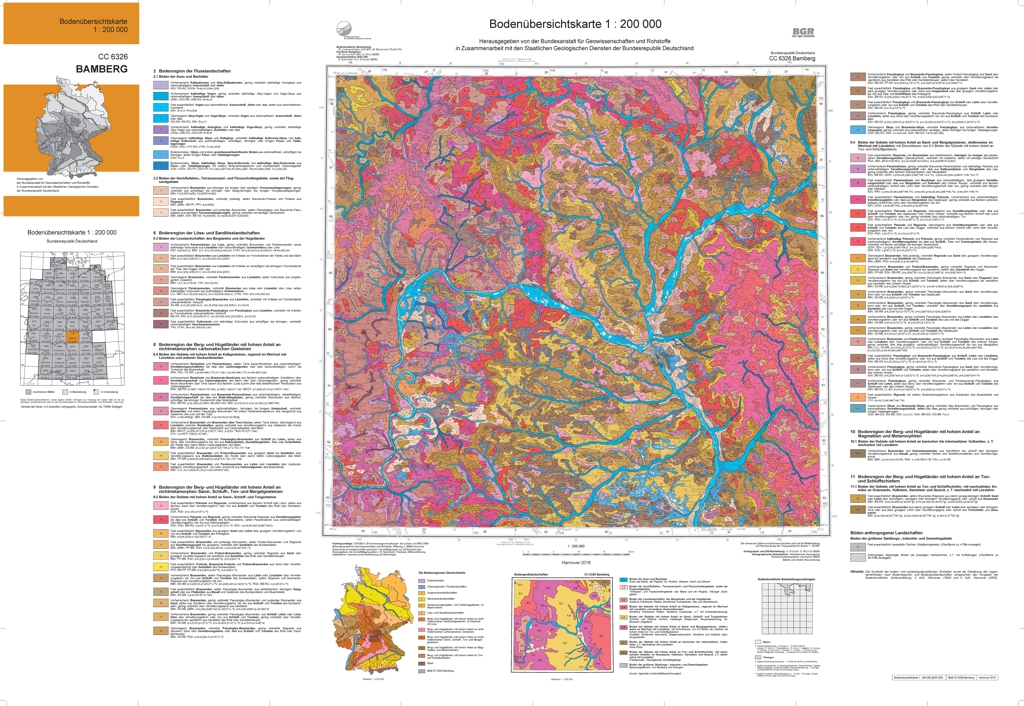
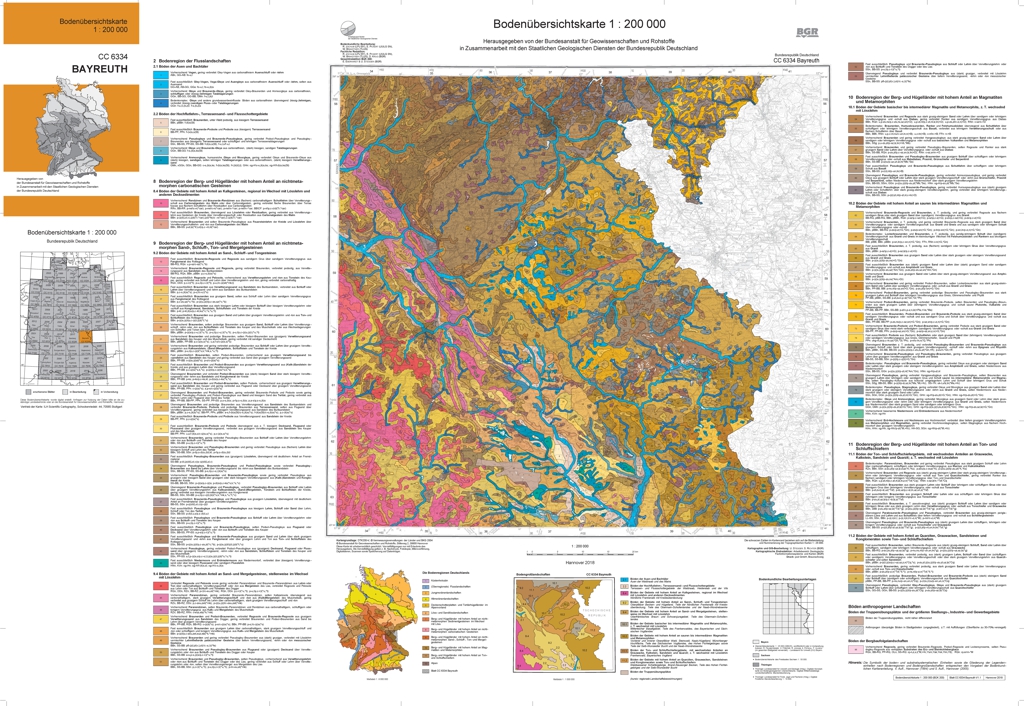
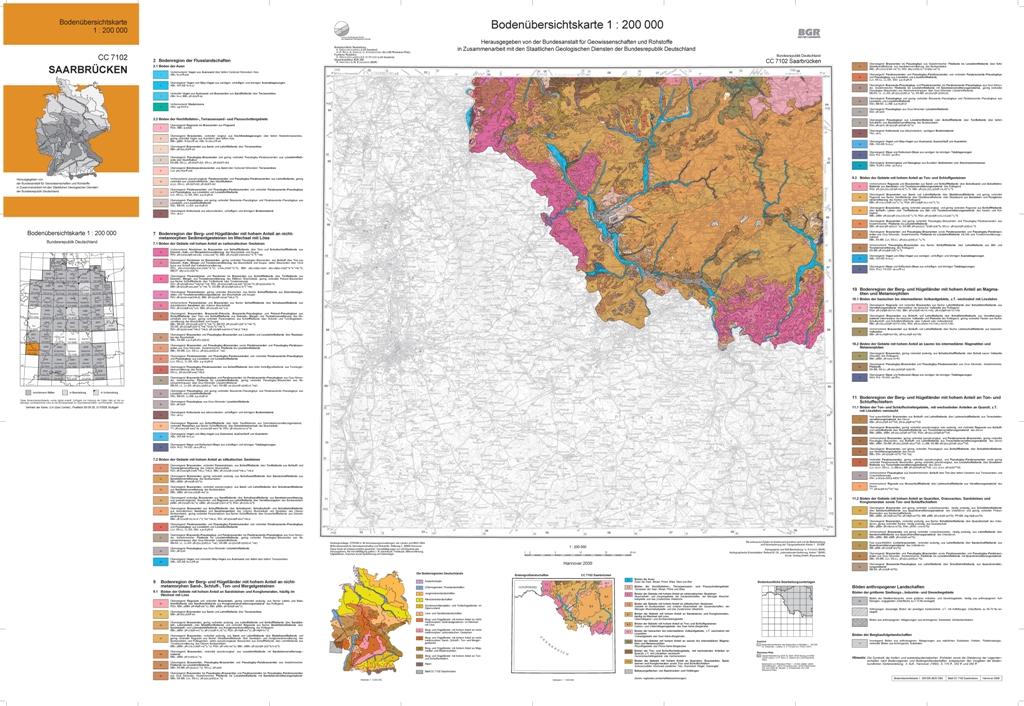
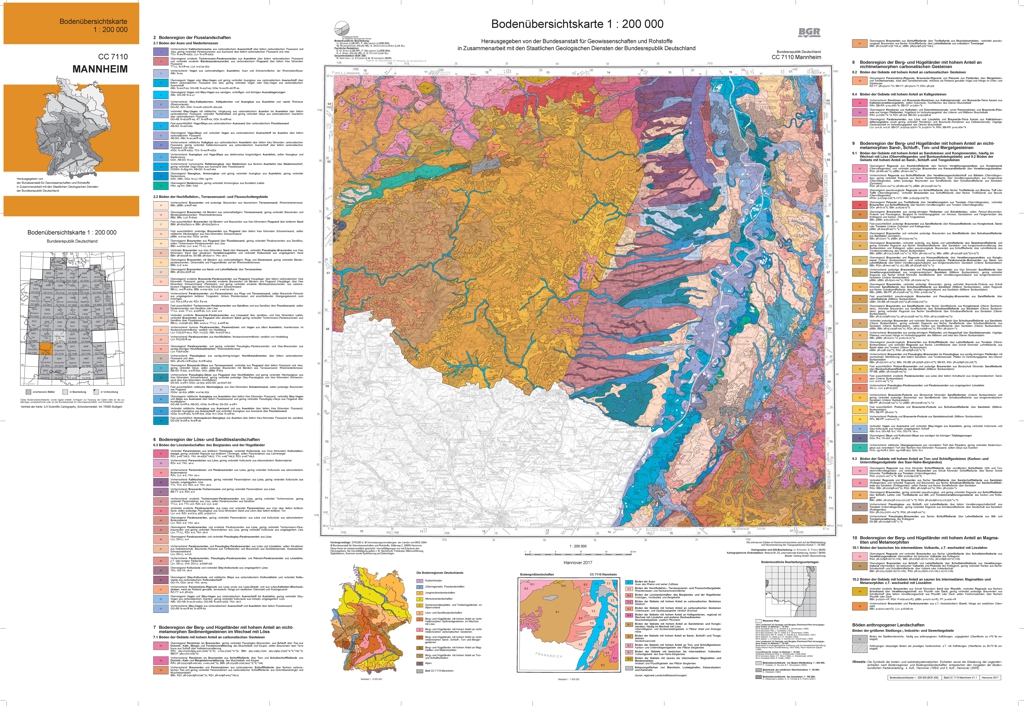
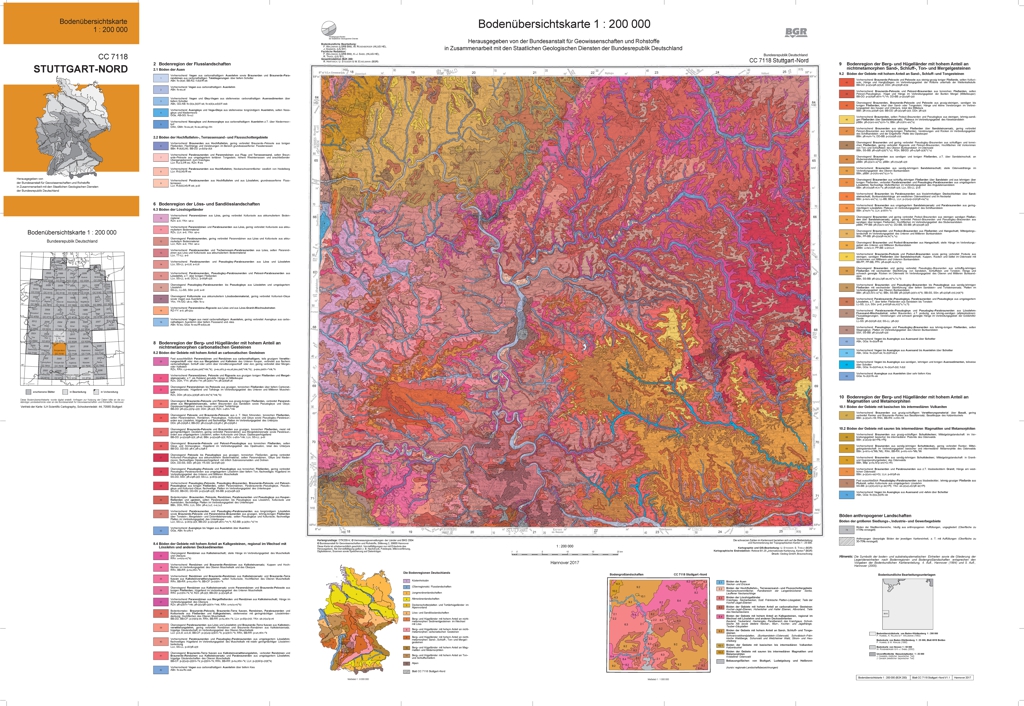
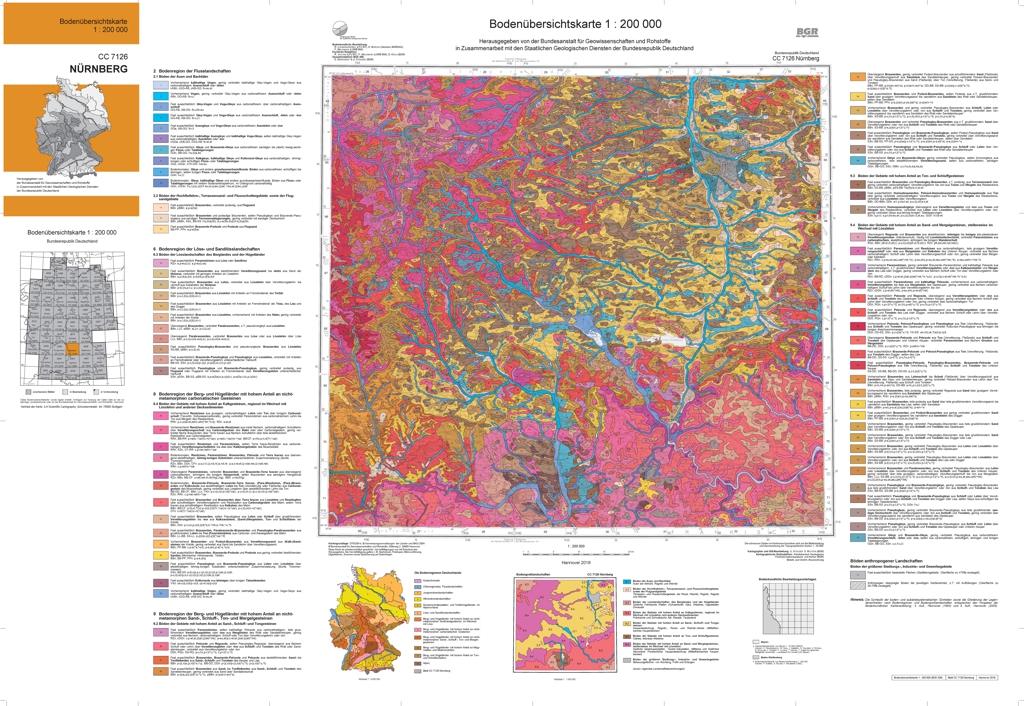
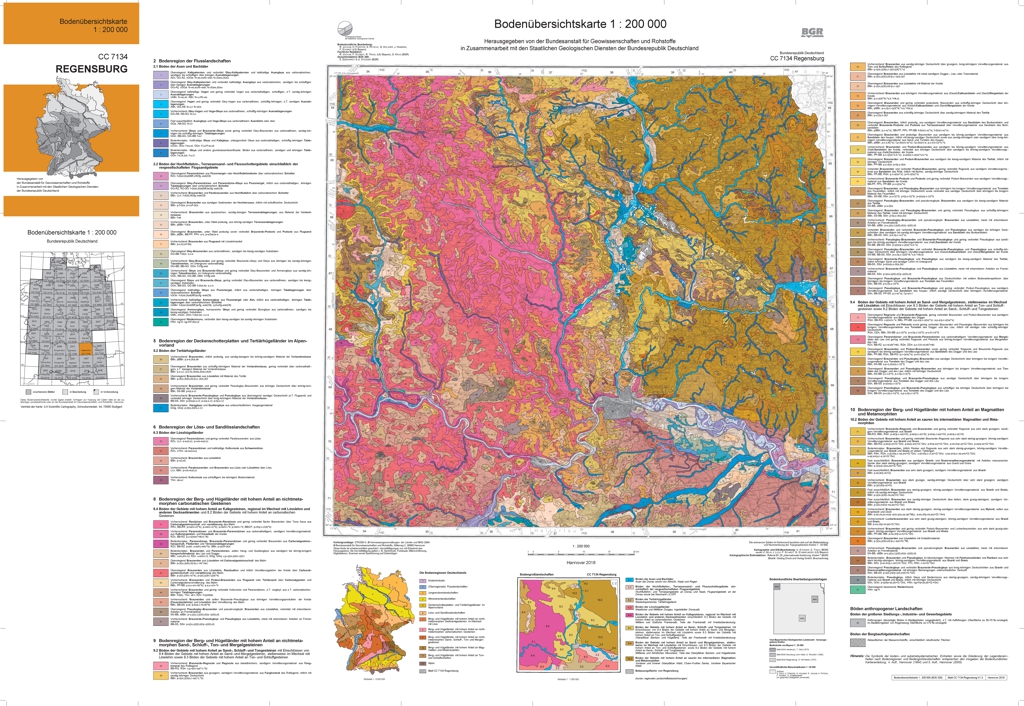
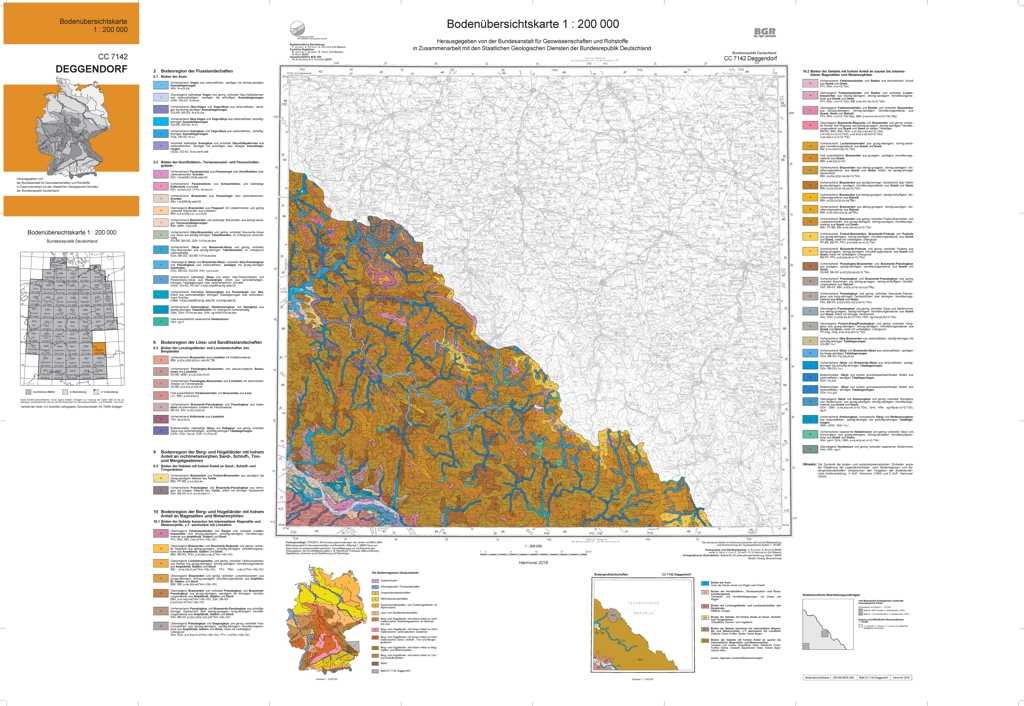
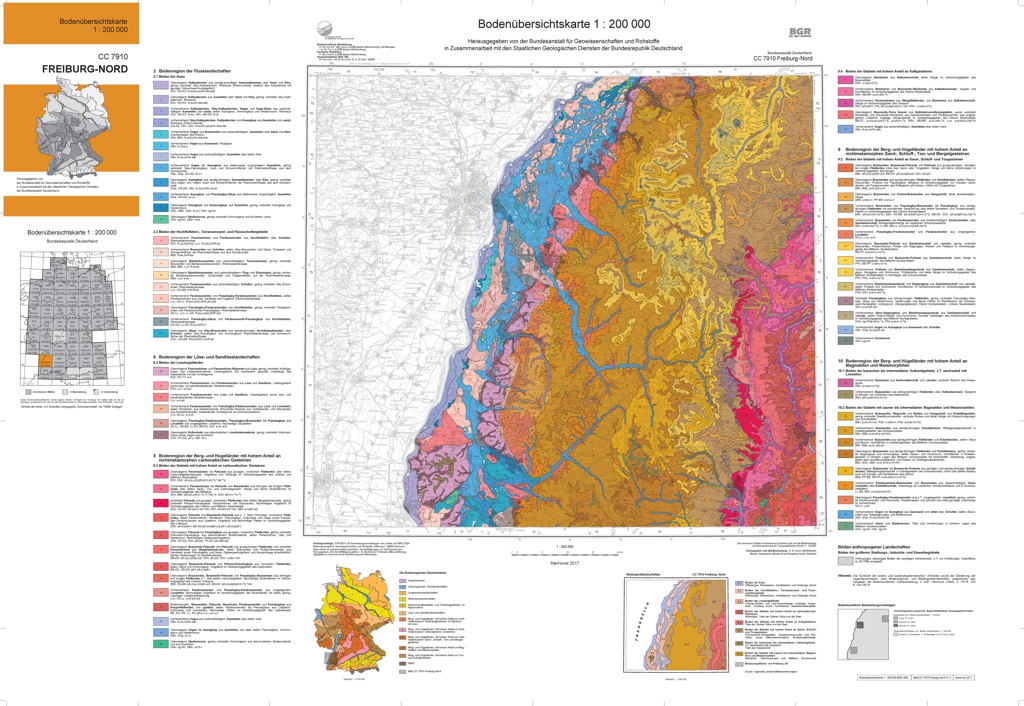
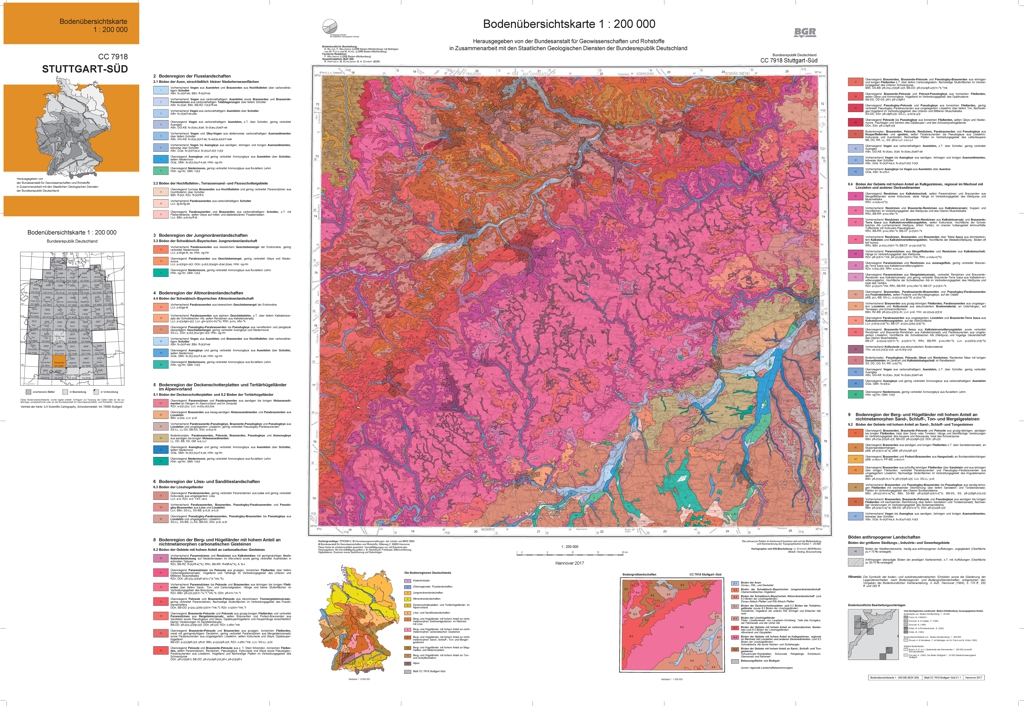
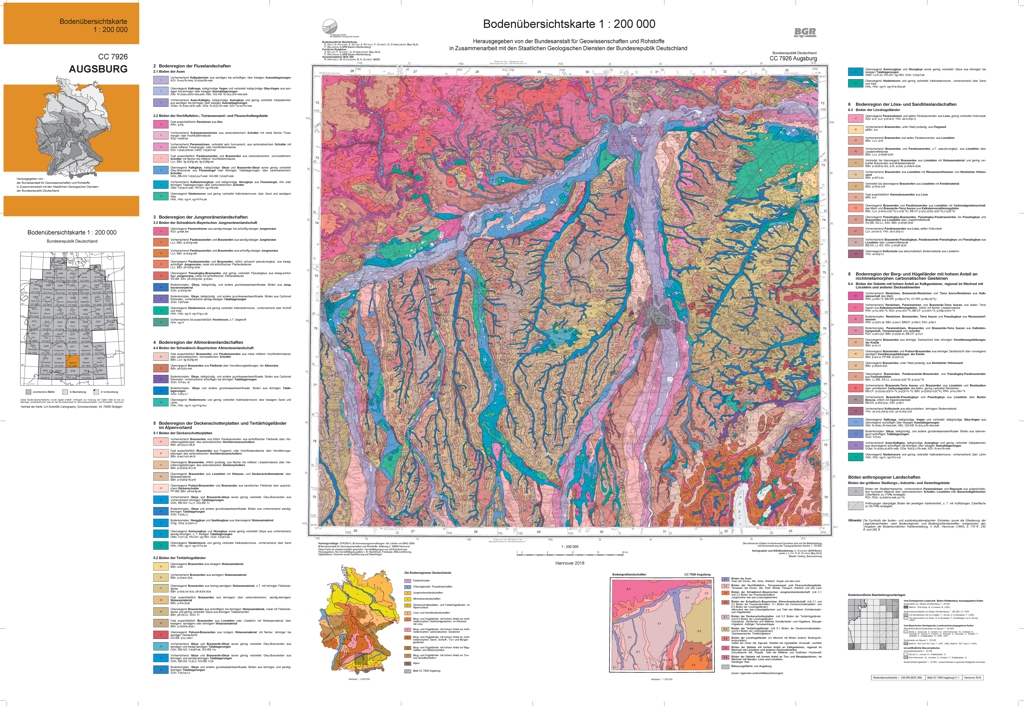
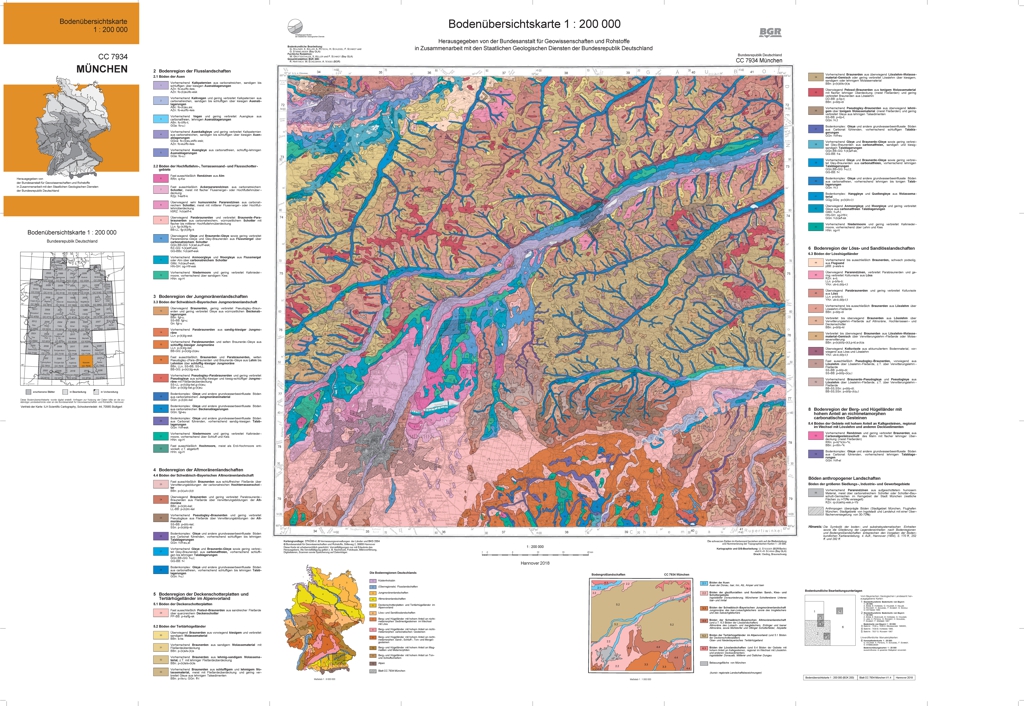
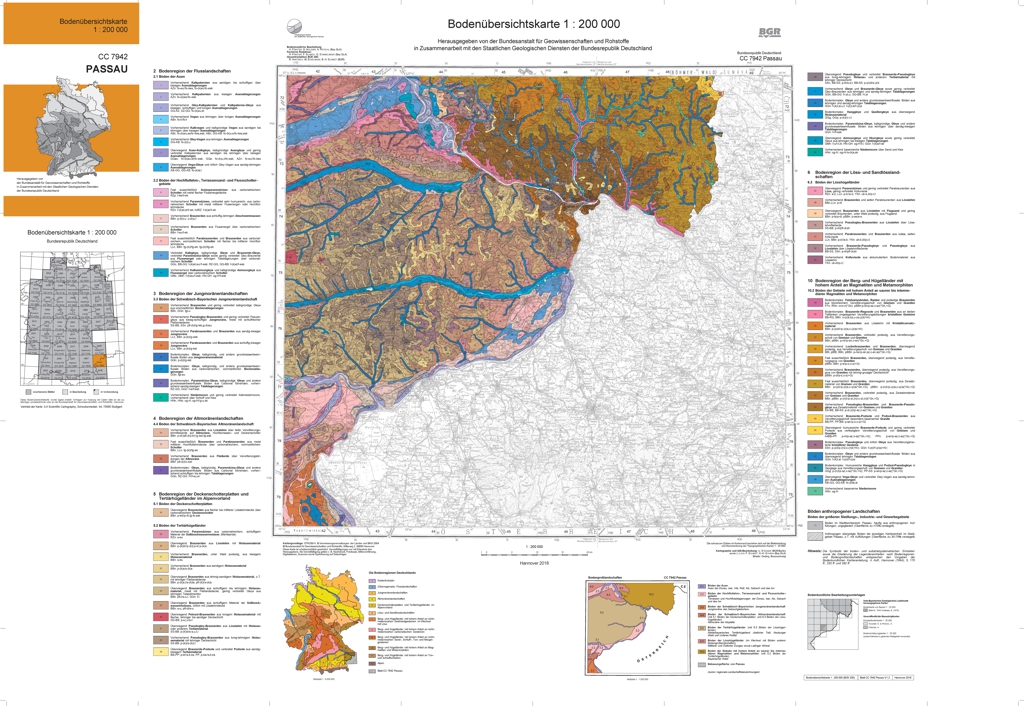
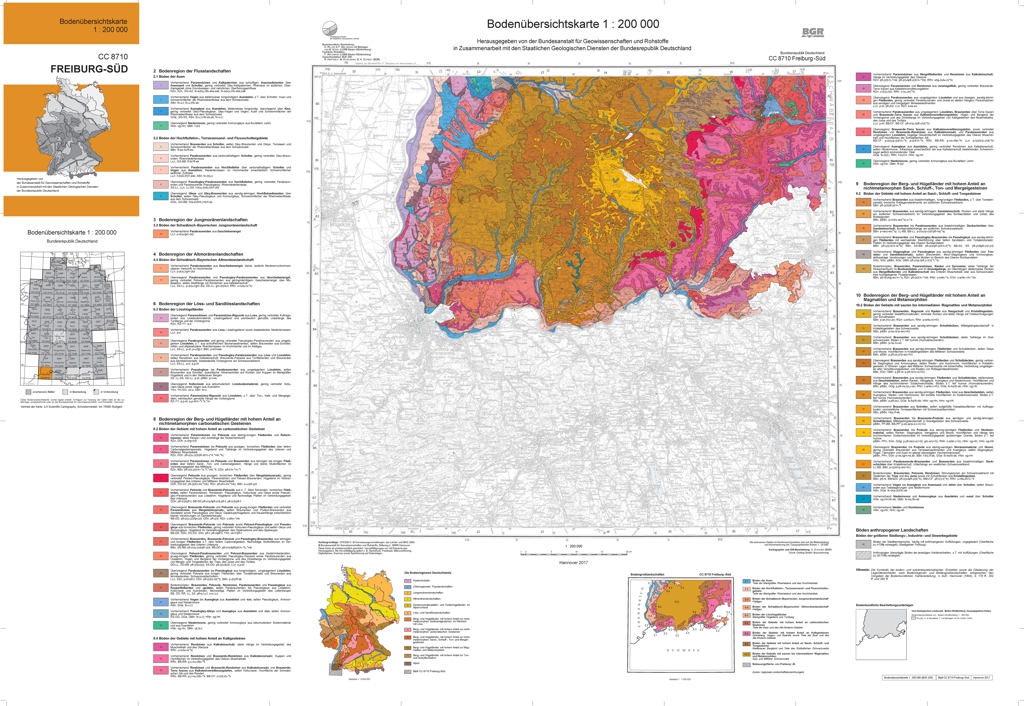
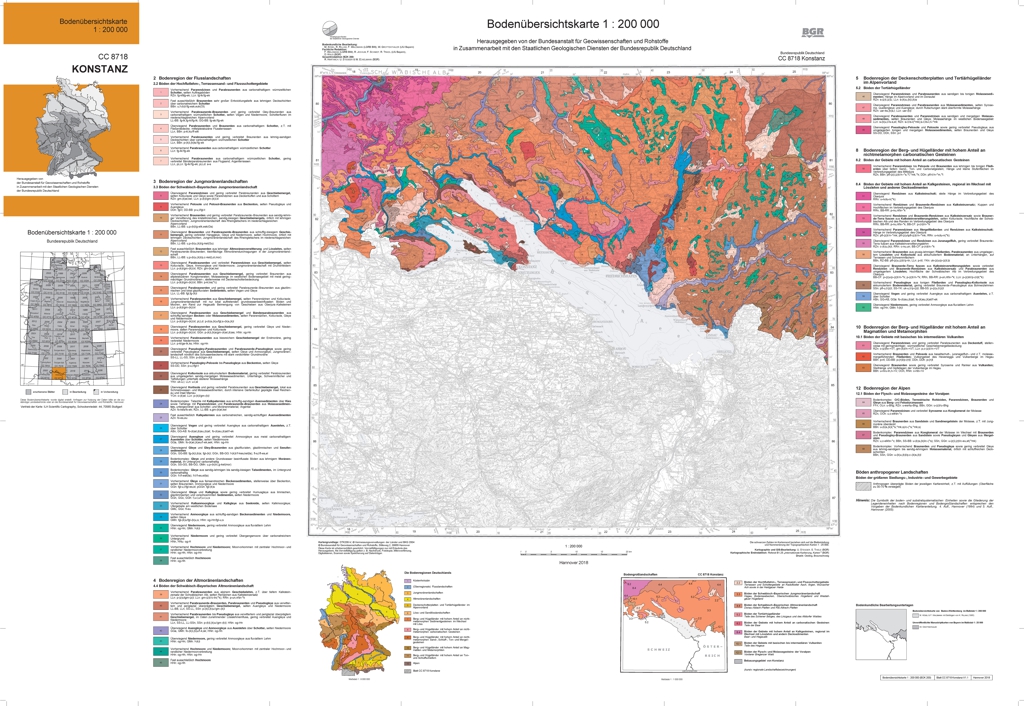
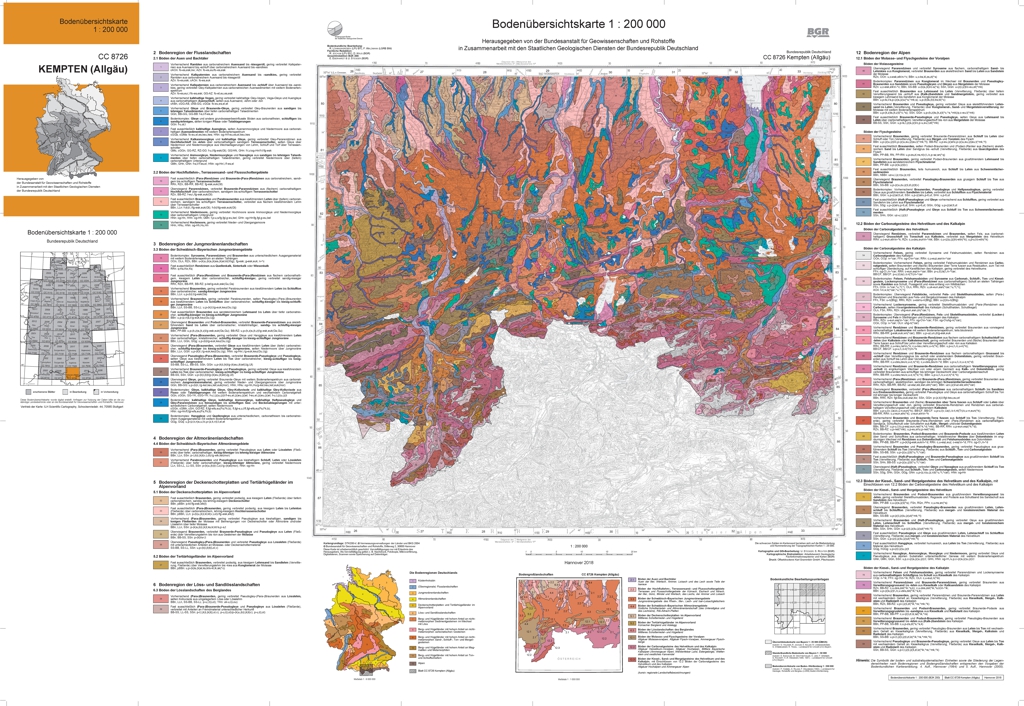
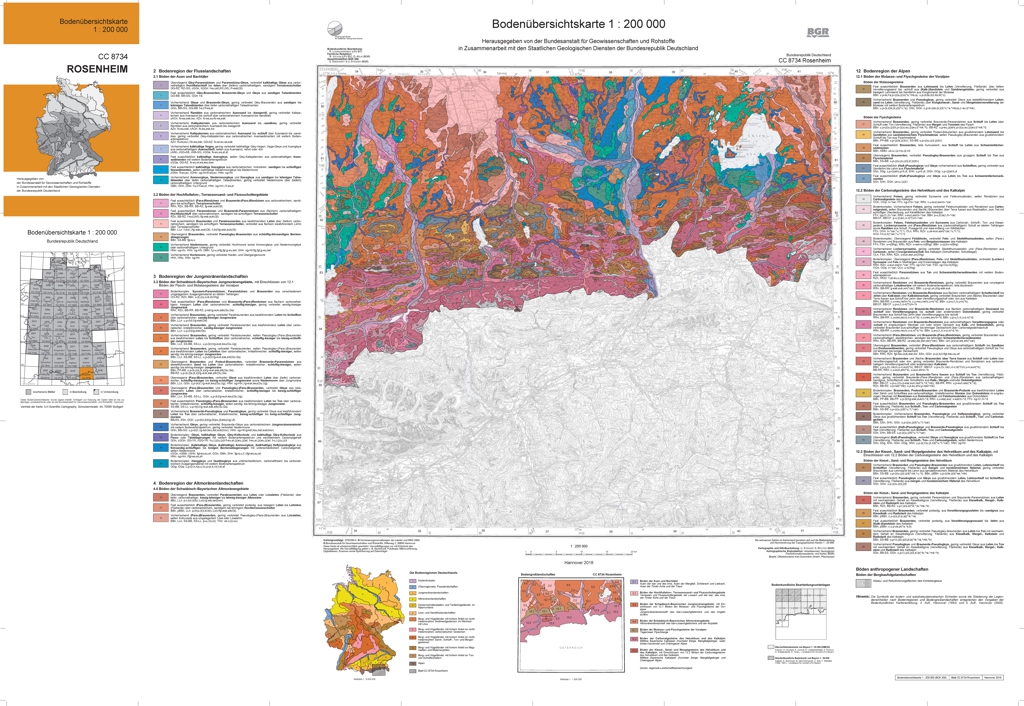
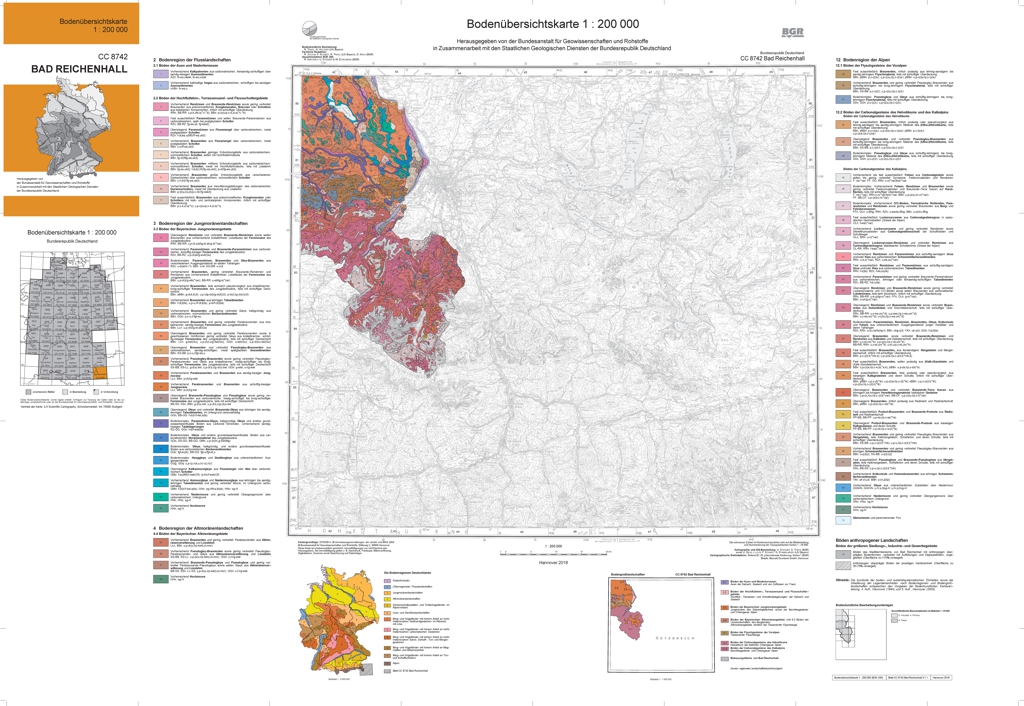
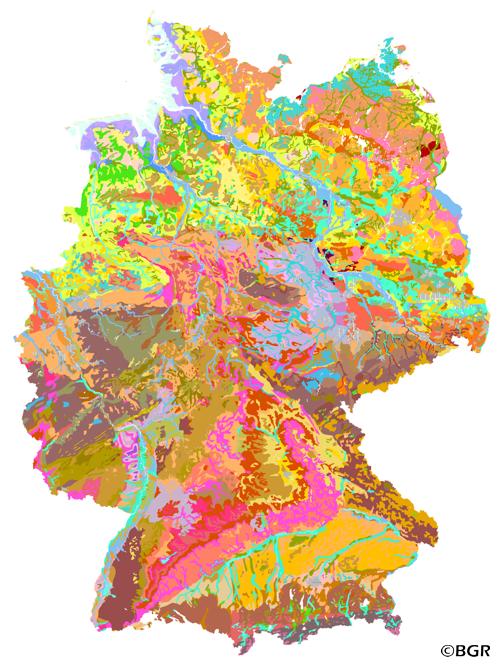
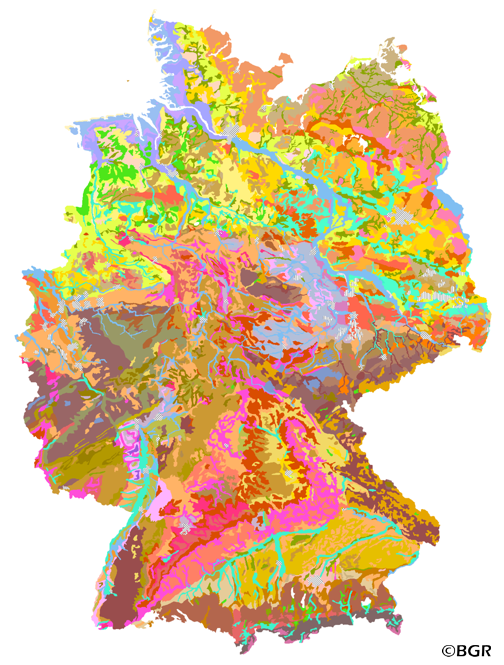
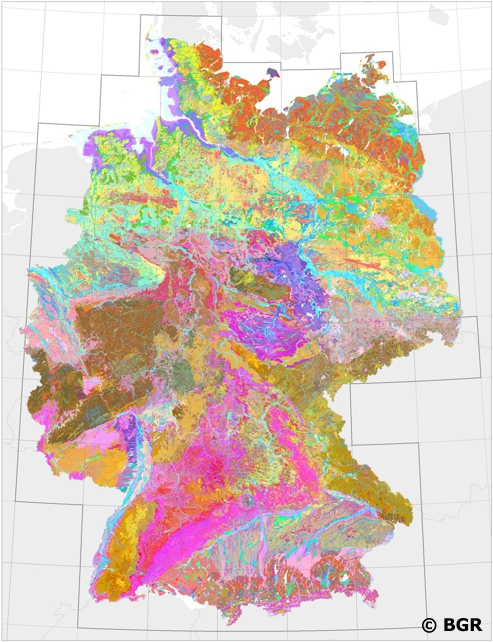
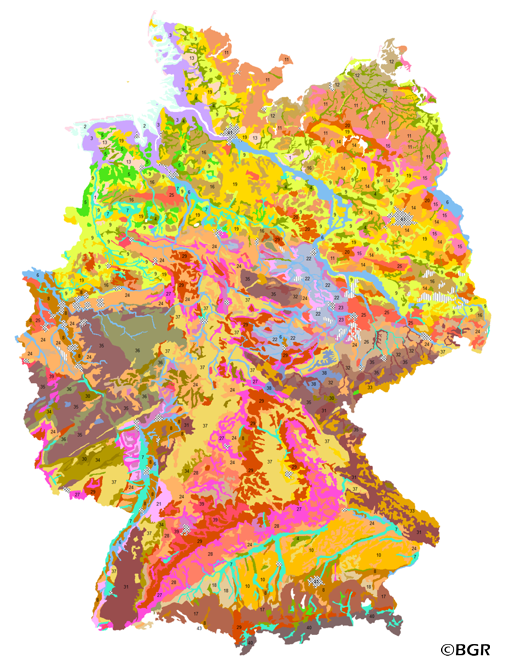
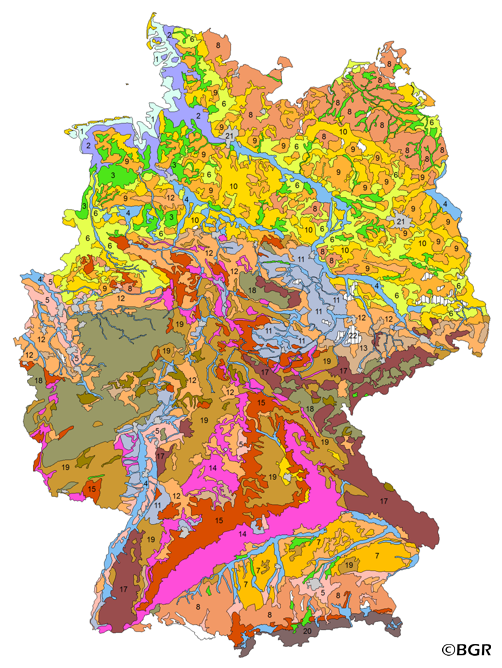
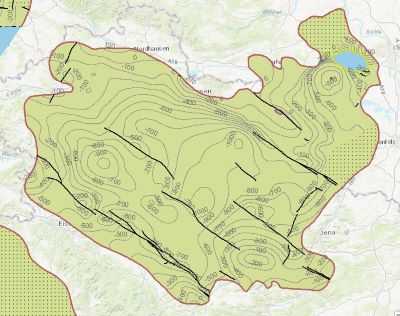
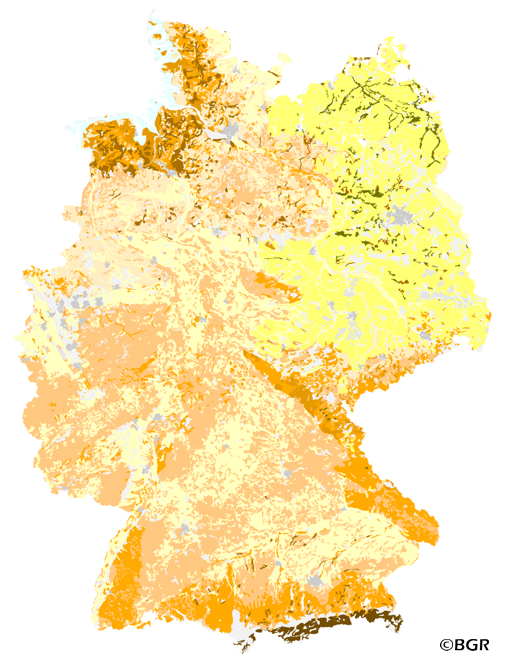
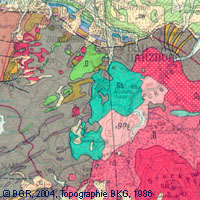
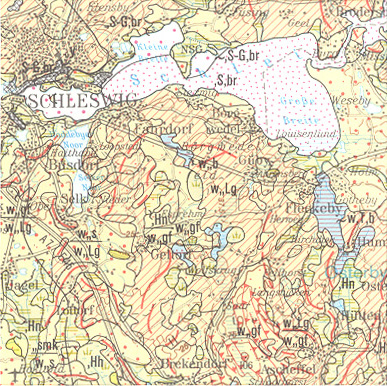

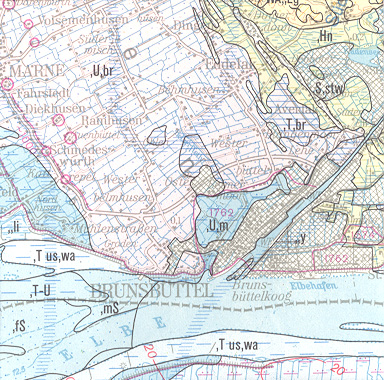
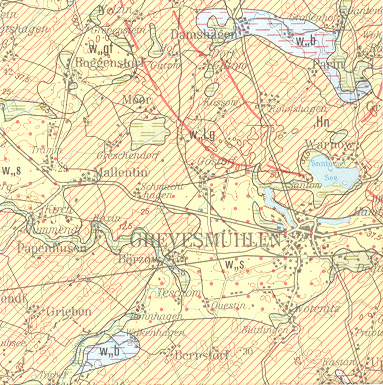
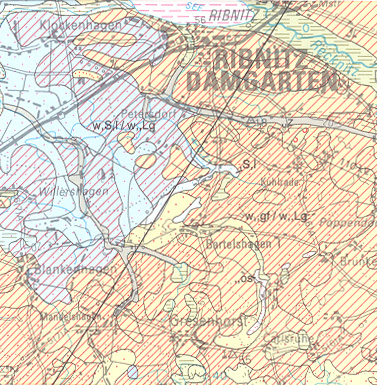
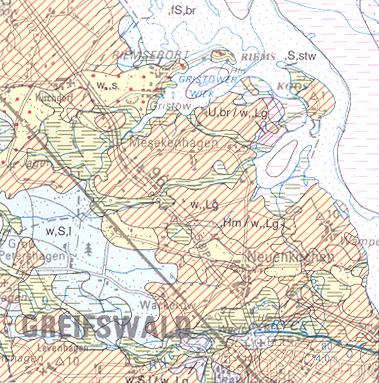
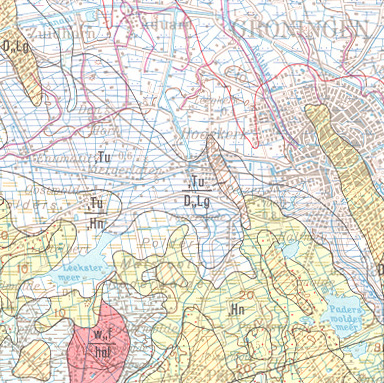
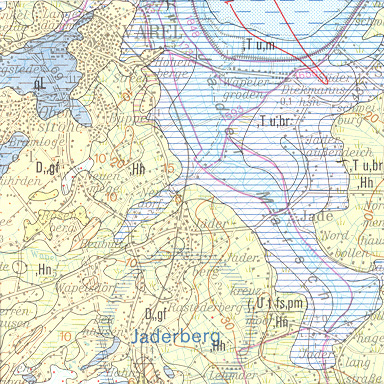
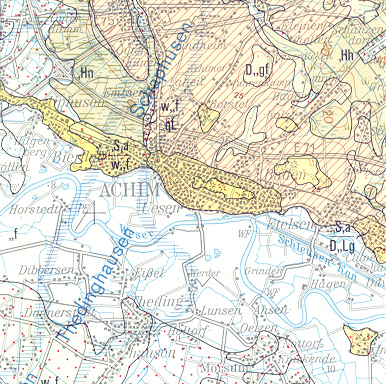
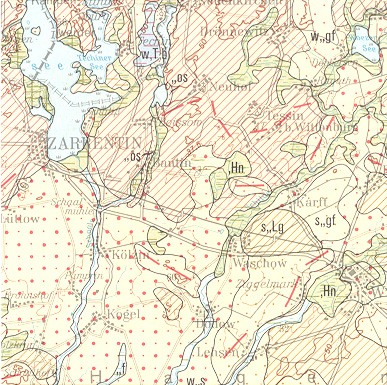
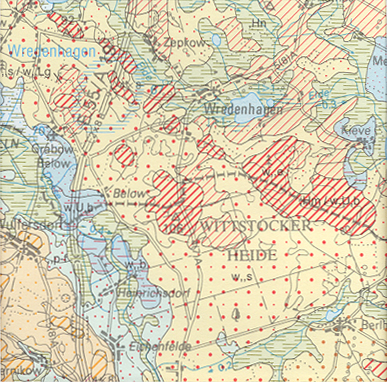
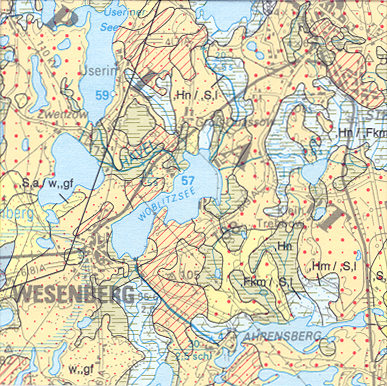
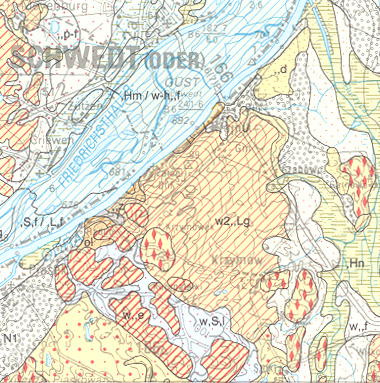
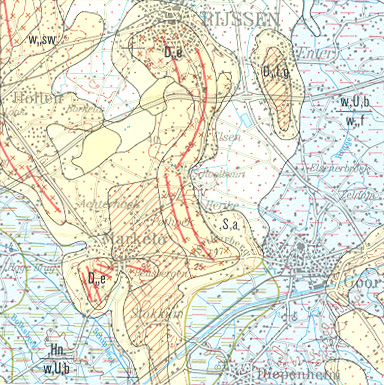
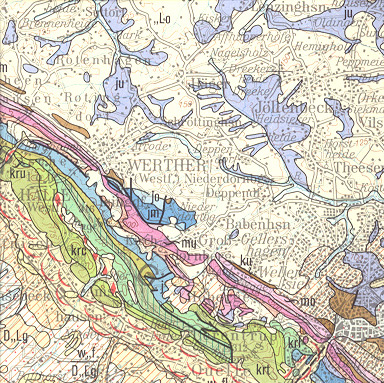
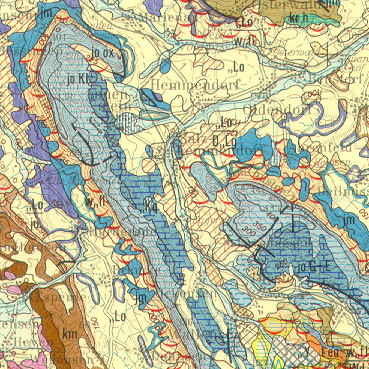
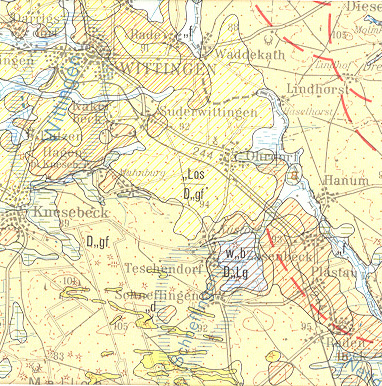
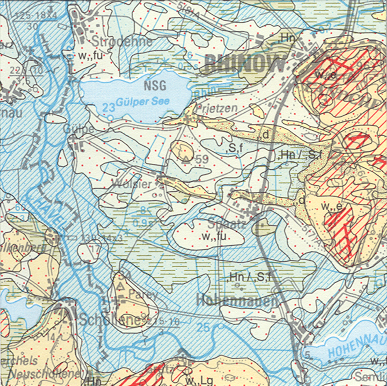
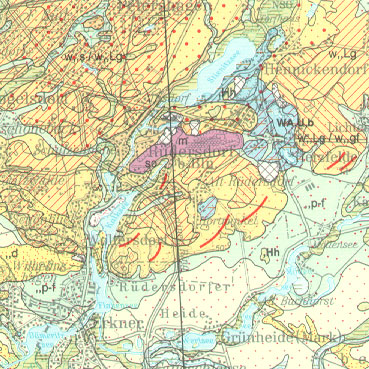
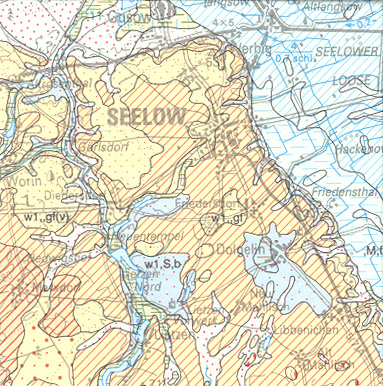

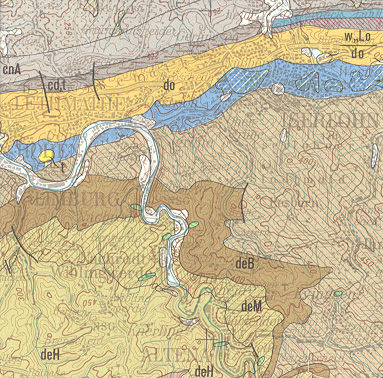
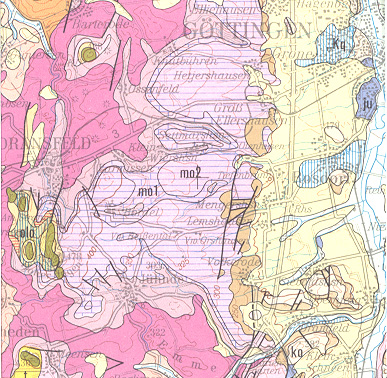
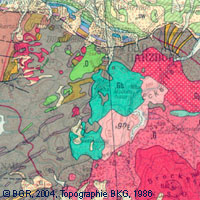

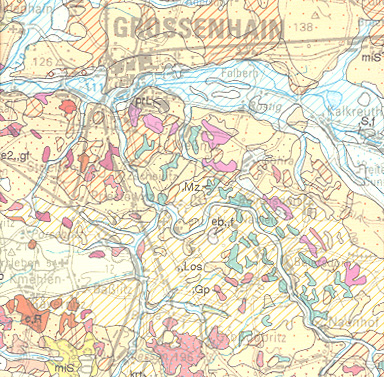
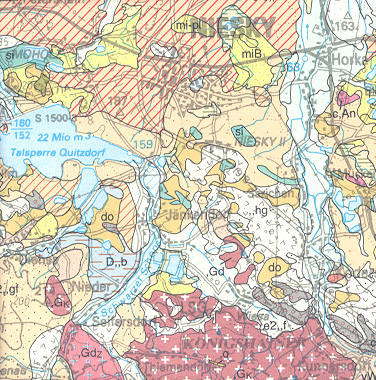
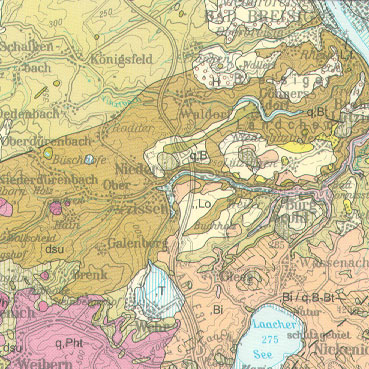
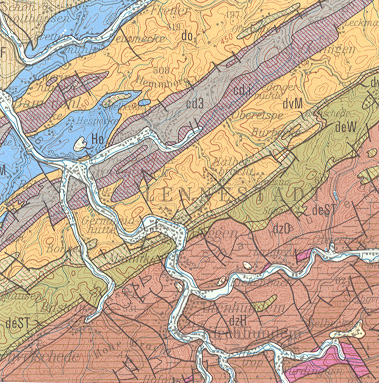
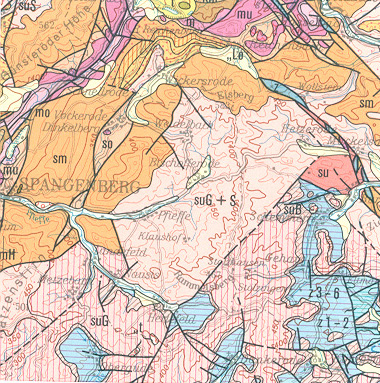
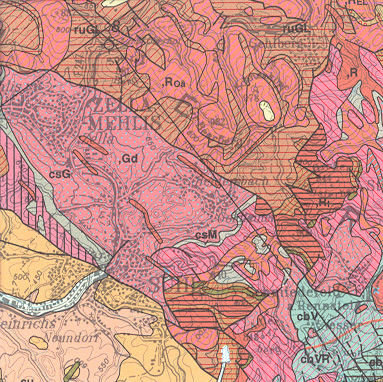
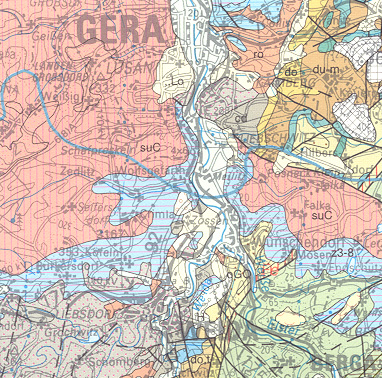
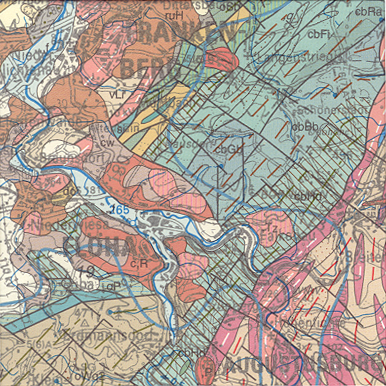
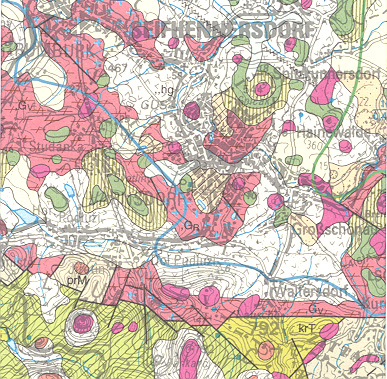

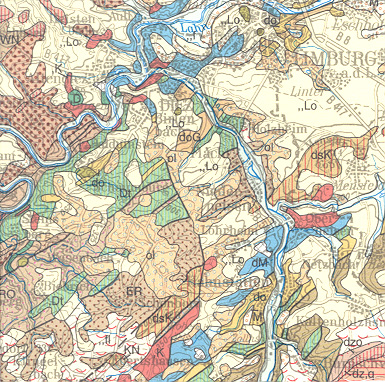
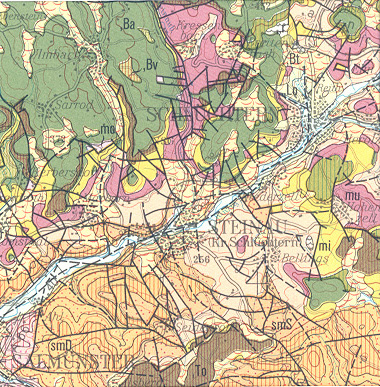
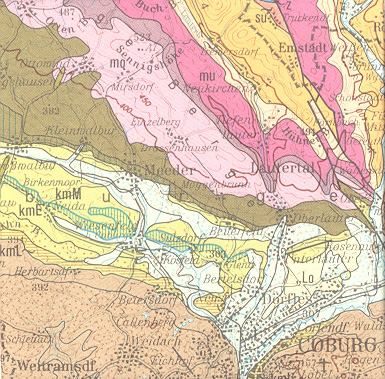
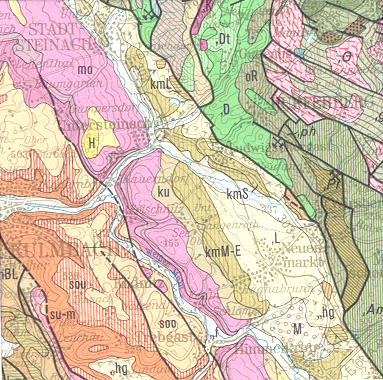
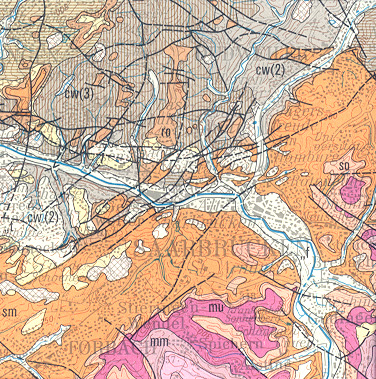
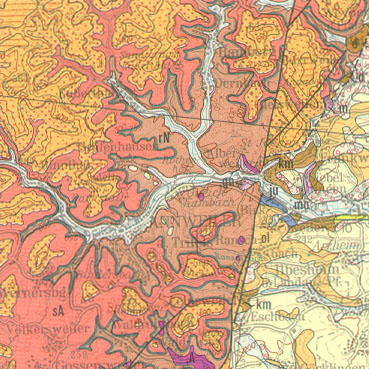
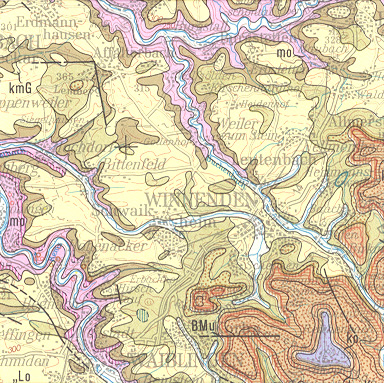
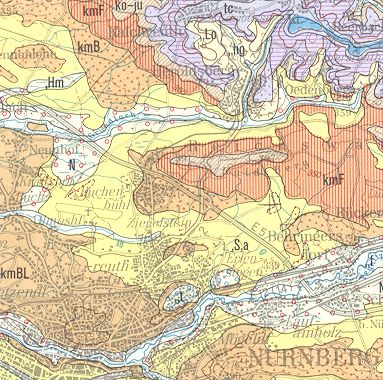
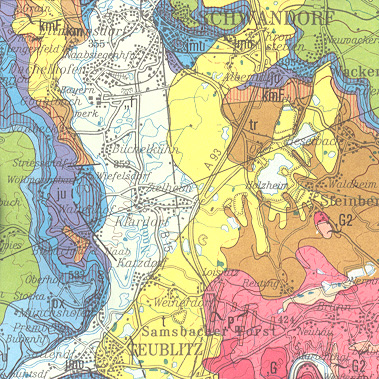
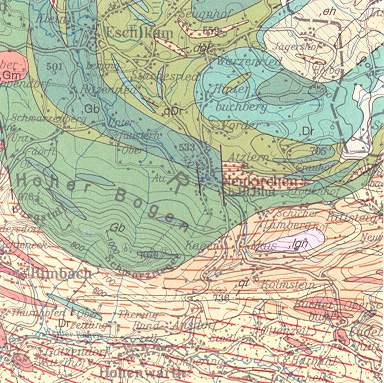
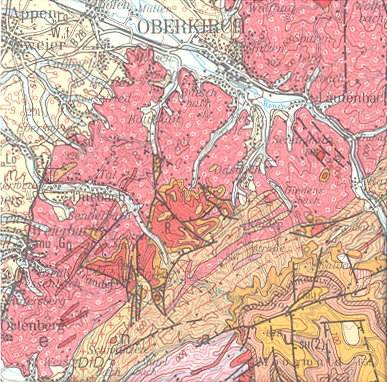
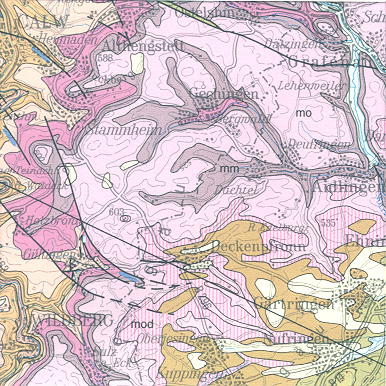
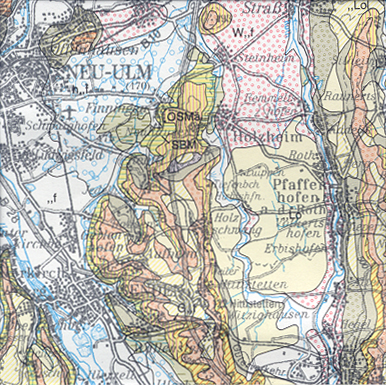
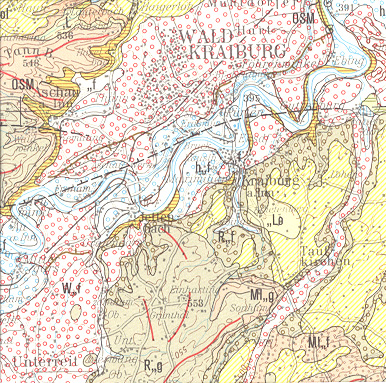
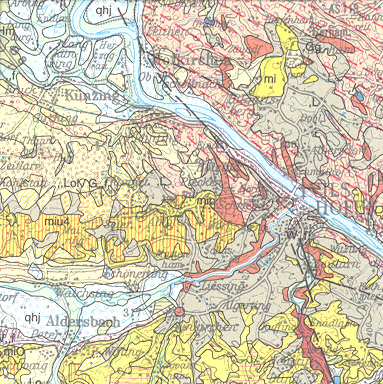
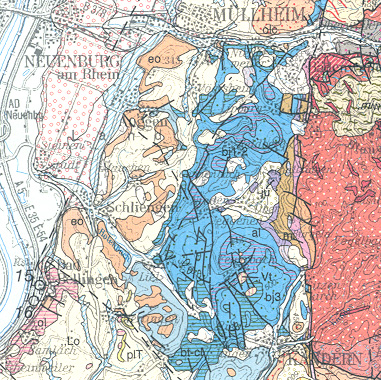
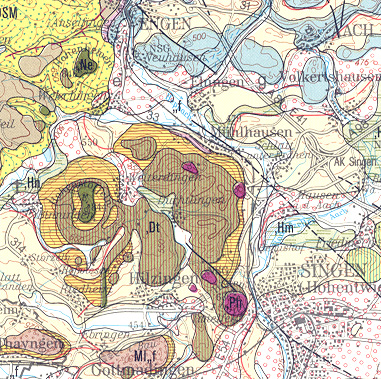
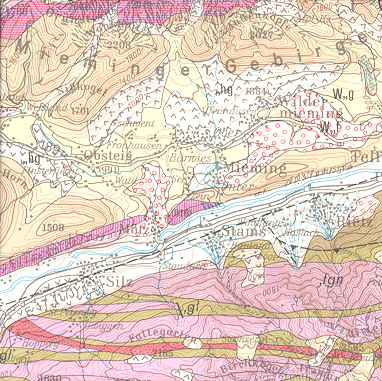
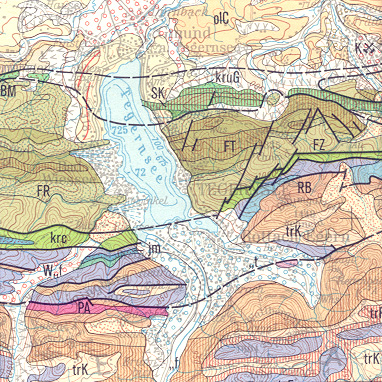

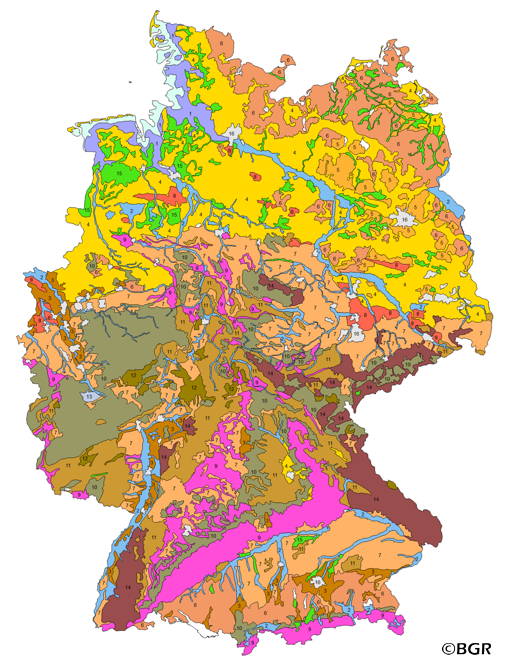
.png)



.png)

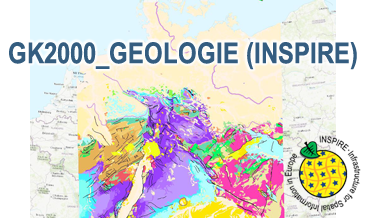














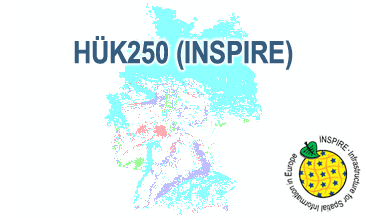
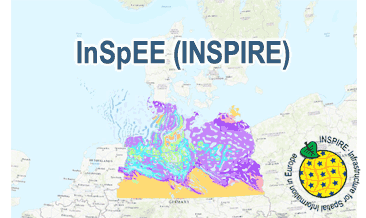


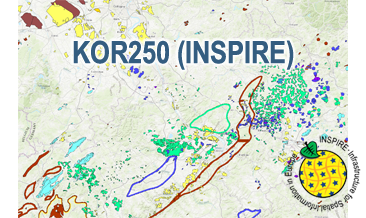

.png)
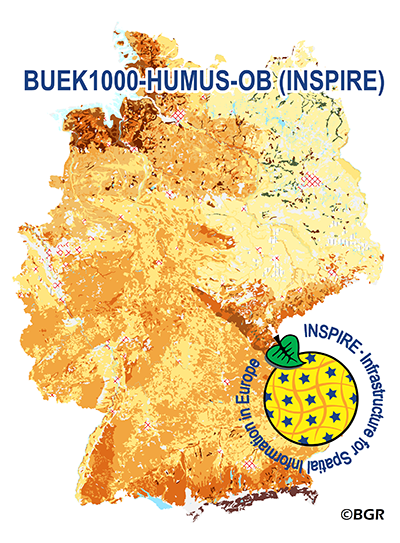

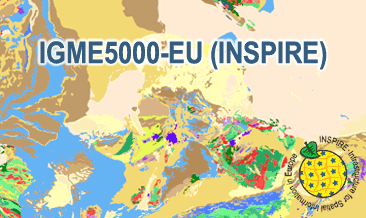
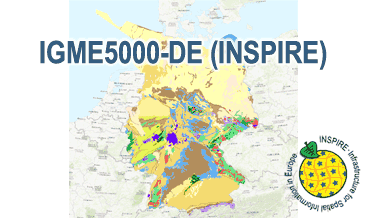


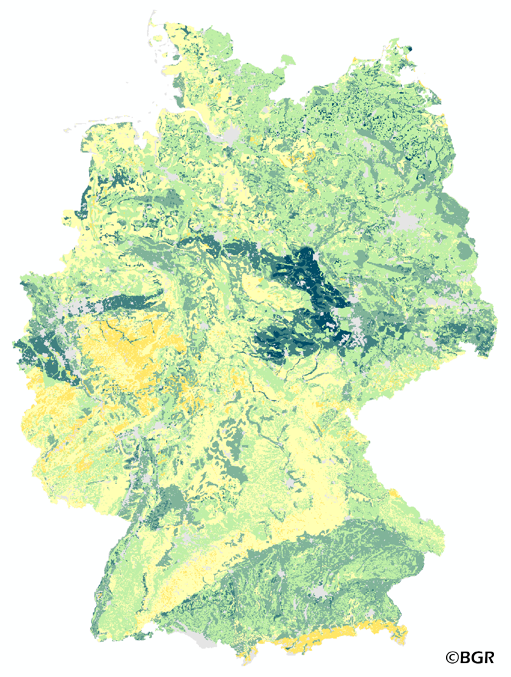
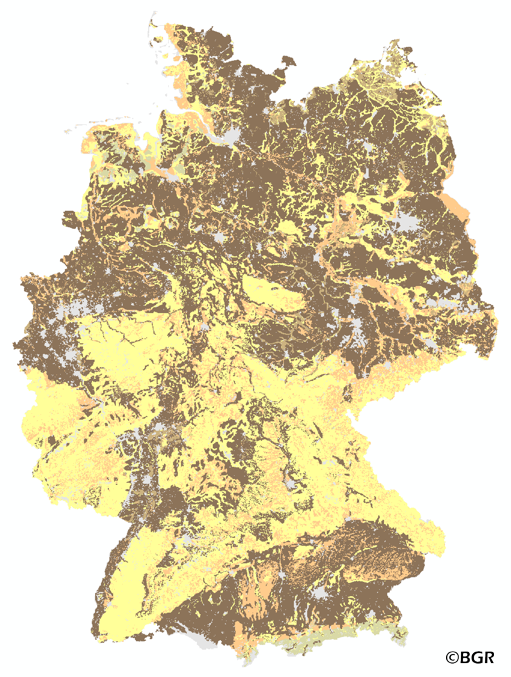
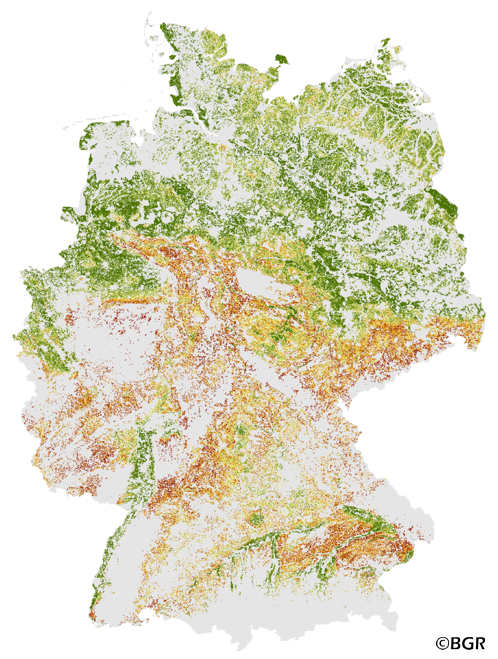
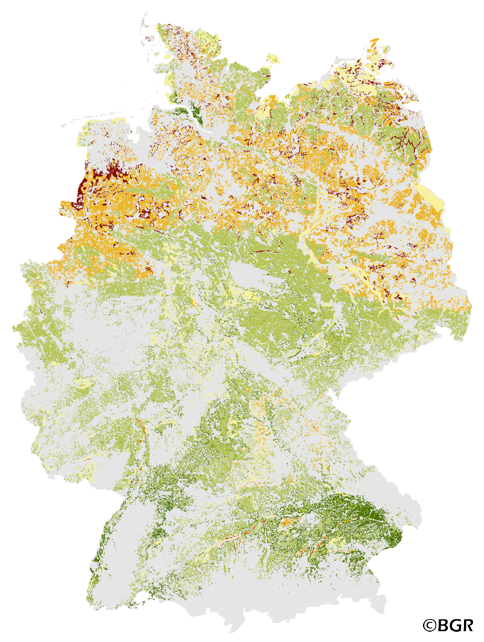
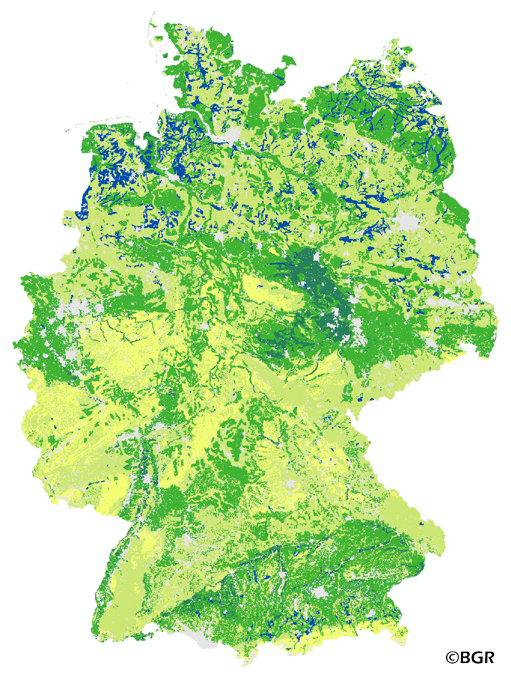
| Identifikator | 98DA31E4-DD6C-4EC2-8638-E8774CBD37C1 |
|---|---|
| Fachliche Grundlage | Abgeleitet aus den inspireidentifizierten Metadatensätzen der BGR. |
| Art des Dienstes | download |
|---|---|
| Version | predefined ATOM |
| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
|---|---|---|
| GetCapabilities | https://services.bgr.de/atomfeeds/service.xml | |
| GetFeature | https://services.bgr.de/atomfeeds/service.xml |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.09 | siehe dazu die angegebene Durchführungsbestimmung |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| xml | n/a |
| Objekt-ID | numis-metadaten-23ab0eae-c777-4372-9536-8a693e61adc2 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 03.02.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | geodatenmanagement@bgr.de |